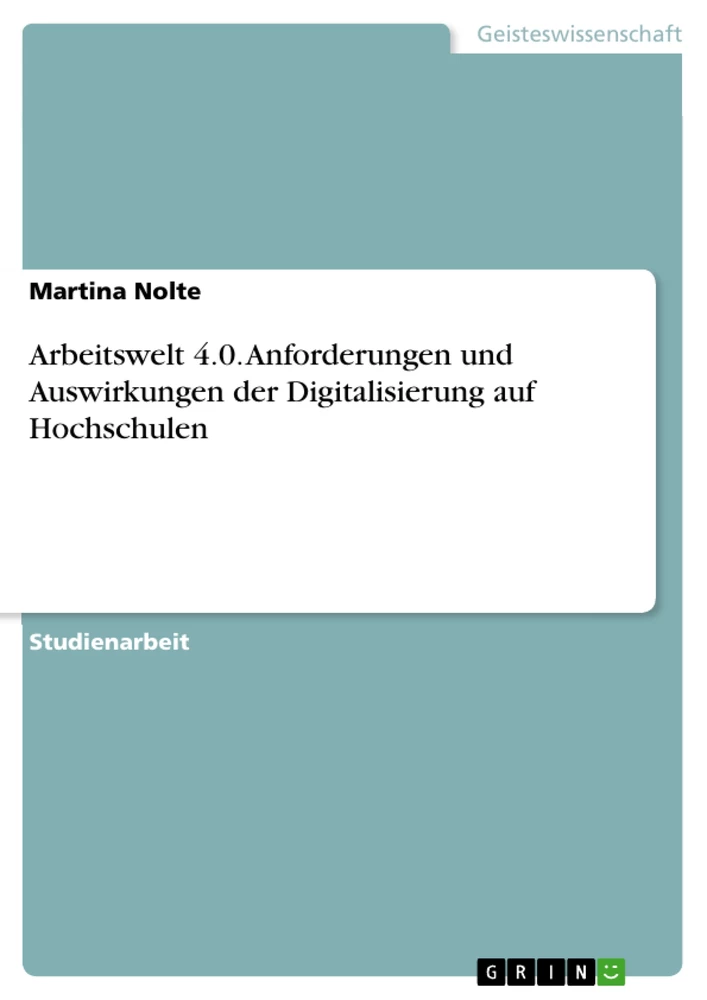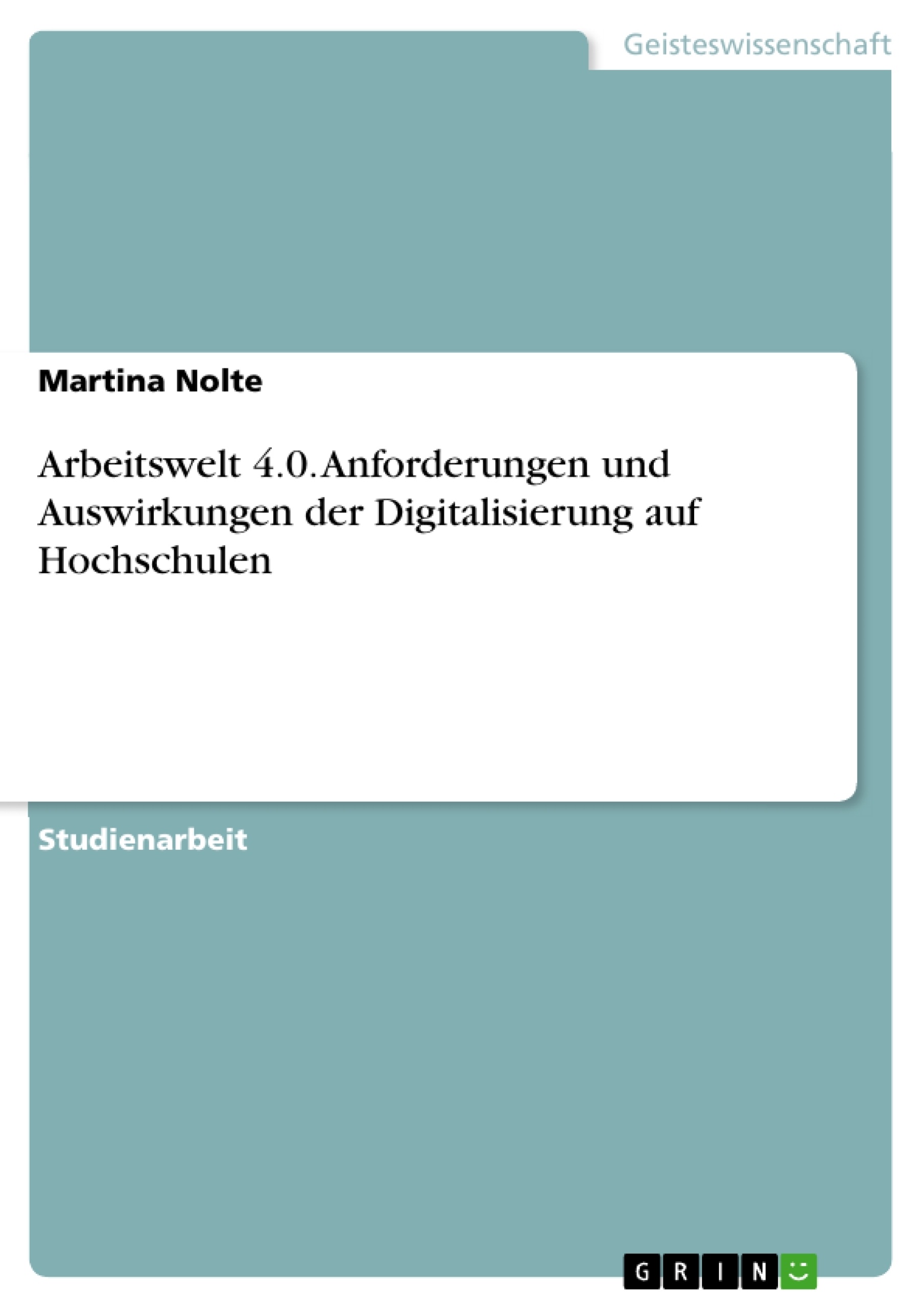Diese Hausarbeit befasst sich mit der Fragestellung, inwieweit Anforderungen an das System "Hochschule" im Rahmen der Arbeitswelt 4.0 gestellt werden und welche Auswirkungen die Digitalisierung auf dieses Konstrukt haben wird. Welche Anforderungen stellt die Arbeitswelt der Zukunft an Akademiker, welche Kompetenzen sollen in der Zukunft vermittelt werden und wie muss sich das Hochschulsystem mit seinen Mitgliedern weiterentwickeln, um diese Kompetenzen vermitteln und diesem Anspruch gerecht werden zu können?
Einem besonderen Wandel unterliegen Tätigkeiten, die sich durch neue Technologien und die Digitalisierung verändern. Bestehende Arbeitsformen werden durch Digitalisierung und Automatisierung auf ein neues Niveau gehoben. Die Technik ergänzt oder ersetzt in der Zukunft nicht nur manuelle Tätigkeiten, sondern übernimmt zunehmend analytisch-intellektuelle Aufgaben. Solche Veränderungen gehen mit einem gesellschaftlichen Wandel und neuen individuellen Wertvorstellungen einher, die sich ebenfalls auf die Arbeitswelt auswirken.
Die junge Generation "Work-Life-Balance" legt großen Wert auf persönliche Weiterentwicklung und Weiterbildung sowie auf Arbeitsformen, die sich nach den eigenen Lebensentwürfen richten. Selbstständiges, eigenverantwortliches und flexibles Arbeiten jenseits und innerhalb von Institutionen spielen hierbei eine bedeutende Rolle. Beleuchtet werden soll ebenfalls, welche Aufgaben die Organisationsentwicklung hierbei hat und wie sie durch geeignete Maßnahmen den Anforderungen gerecht wird.
Diese Ausarbeitung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es soll lediglich versucht werden, einen Gesamtüberblick über die aktuelle Lage an Hochschulen darzustellen und aufzuzeigen, welche Rolle dabei die Organisationsentwicklung mit geeigneten Maßnahmen übernehmen kann. Im Anschluss soll in einem Fazit versucht werden, einen Ausblick über die noch zu erwartenden Veränderungen, auch in Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung, zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Arbeitswelt 4.0
- 2.1 Die vier Revolutionen - von 1.0 zu 4.0
- 2.2 Digitalisierung – Definition, Grundlagen etc.
- 3. Das System „Hochschule“
- 3.1 Definition Hochschule
- 3.2 Hochschultypen
- 3.3 Auswirkungen der Digitalisierung an Hochschulen
- 3.4 Strukturwandel und seine Folgen an Hochschulen
- 4. Aufgaben der Organisationsentwicklung im Veränderungsprozess
- 4.1 Organisationsentwicklung - Definition
- 4.2 Anforderungen an die Organisationsentwicklung und Mitarbeiter
- 4.3 Schaffung geeigneter Maßnahmen- Kompetenzaufbau
- 5. Exkurs „, YouTube als Fernlehrschule“ von Prof. Dr. Walter Simon
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf Hochschulen im Kontext der Arbeitswelt 4.0. Sie analysiert, welche Herausforderungen und Anforderungen die Digitalisierung für das System „Hochschule“ mit sich bringt und welche Kompetenzen Studierende und Mitarbeiter benötigen, um sich auf diese veränderte Arbeitswelt vorzubereiten.
- Die vier industriellen Revolutionen und die Entwicklung der Arbeitswelt
- Die Definition und Auswirkungen der Digitalisierung auf Hochschulen
- Der Strukturwandel an Hochschulen im Zuge der Digitalisierung
- Die Rolle der Organisationsentwicklung bei der Bewältigung des Veränderungsprozesses
- Die Bedeutung von Kompetenzaufbau für Studierende und Mitarbeiter an Hochschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die Relevanz der Digitalisierung für Hochschulen im Hinblick auf die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0. Es wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Aspekte der Thematik gegeben, die im weiteren Verlauf der Arbeit detailliert untersucht werden.
Kapitel 2: Arbeitswelt 4.0 erläutert die vier industriellen Revolutionen und die Entwicklung der Arbeitswelt, von der mechanisierten Produktion bis zur digitalen Vernetzung. In diesem Zusammenhang wird auch die Bedeutung der Digitalisierung im Kontext der Arbeitswelt 4.0 dargestellt.
Kapitel 3: Das System „Hochschule“ definiert den Begriff Hochschule und beschreibt die verschiedenen Hochschultypen. Es analysiert die Auswirkungen der Digitalisierung auf das System „Hochschule“ und die Folgen des Strukturwandels für Hochschulen.
Kapitel 4: Aufgaben der Organisationsentwicklung im Veränderungsprozess erläutert die Rolle der Organisationsentwicklung im Kontext der Digitalisierung an Hochschulen. Es werden Anforderungen an die Organisationsentwicklung und Mitarbeiter definiert sowie geeignete Maßnahmen zur Förderung von Kompetenzaufbau vorgestellt.
Kapitel 5: Exkurs „, YouTube als Fernlehrschule“ von Prof. Dr. Walter Simon ist ein Exkurs, der das Thema der Digitalisierung in der Lehre aus einer besonderen Perspektive beleuchtet.
Schlüsselwörter
Arbeitswelt 4.0, Digitalisierung, Hochschule, Organisationsentwicklung, Kompetenzaufbau, Strukturwandel, Veränderungsprozess, Industrie 4.0, digitale Transformation.
- Quote paper
- Martina Nolte (Author), 2017, Arbeitswelt 4.0. Anforderungen und Auswirkungen der Digitalisierung auf Hochschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/369426