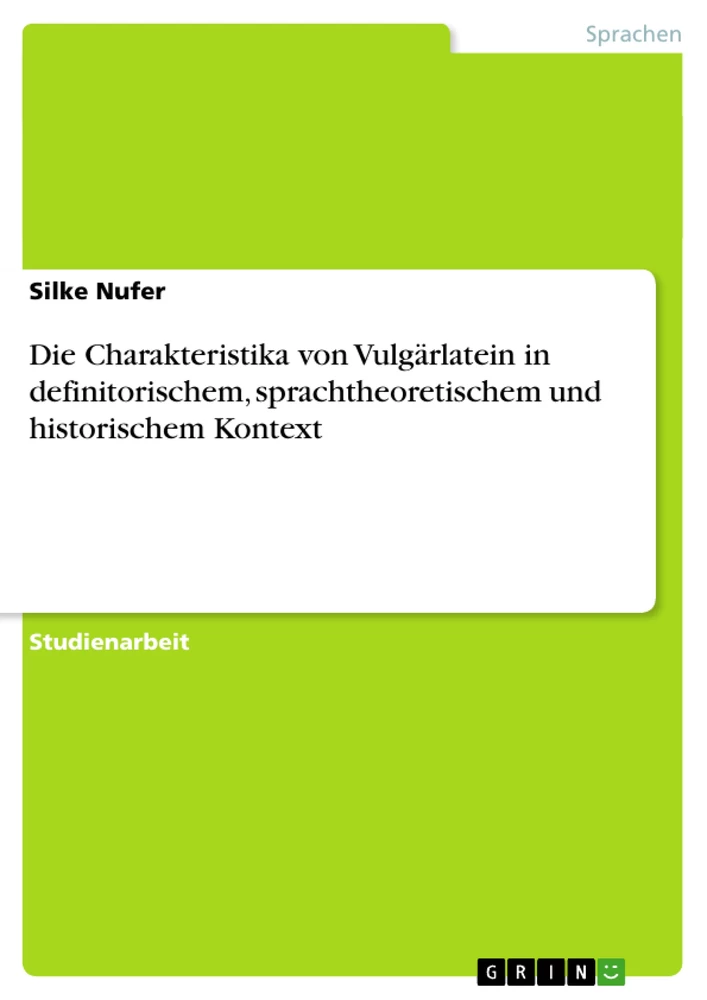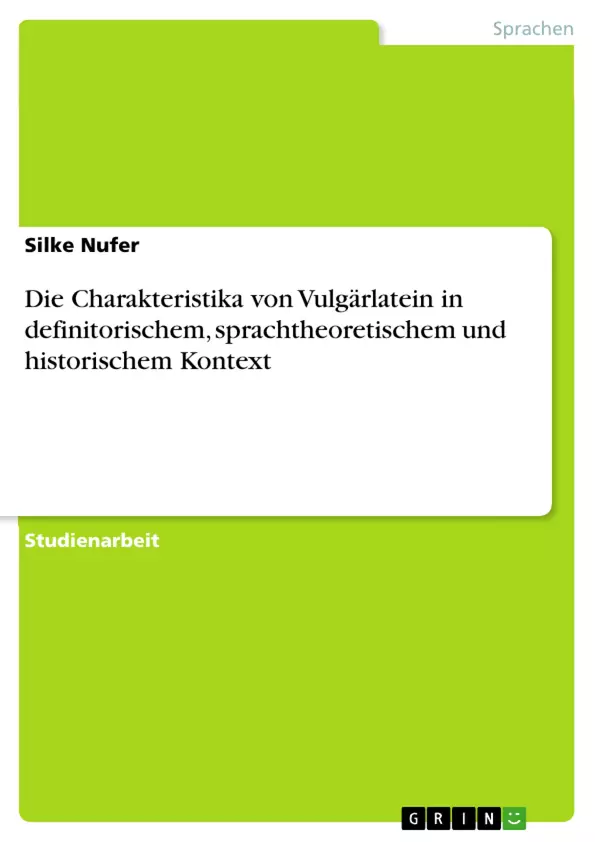Wenn die in heutiger Form existierenden romanischen Sprachen miteinander verglichen werden, bemerkt man viele Ähnlichkeiten. Hierbei wirft sich die Frage auf, worauf diese Ähnlichkeiten zurückzuführen sind. Bekanntlich liegen die Wurzeln der heutigen romanischen Sprachen im Lateinische n. Die uns heute noch erhaltenen lateinischen Quellen von bekannten Autoren belegen jedoch, dass das klassische Latein, in welchem die Intellektuellen der Antike ihre Schriften verfassten, stark von den oben genannten modernen romanischen Sprachen abweicht. Auch erklärt das klassische Latein in keiner Weise die heutigen bestehenden Unterschiede zwischen den romanischen Sprachen. Es wurden aber neben den klassischen Schriften weitere Quellen gefunden, welche ein anderes Latein dokumentieren – ein Latein, in welchem mündliche, d.h. der Umgangssprache entnommene Elemente festgehalten wurden. Diese Form des Lateins wird als Vulgärlatein bezeichnet, welches als die Grundlage der Entwicklung hin zu allen romanischen Sprachen angesehen wird. Viele Romanisten heben hervor, dass die Bezeichnung „Vulgärlatein“ kein glücklich gewählter Terminus sei. Trotzdem hat sich diese Bezeichnung in der romanischen Sprachwissenschaft durchgesetzt. Dass man Anstoß an diesem Terminus nimmt, liegt im Element „Vulgär-“, welcher fälschlicherweise mit einer soziokulturellen oder stilistischen Zuordnung dieser bestimmten Varietät des Lateins in Verbindung gebracht wurde. Vulgärlatein wurde als das Latein der unteren Volksschichten, als die Sprache des Pöbels verstanden. Linguisten, die s olche terminologischen Schwierigkeiten vermeiden wollen, verwenden Termini wie „sogenanntes Vulgärlatein“ (Coseriu), „Verkehrslatein“, „Umgangslatein“ (Reichenkron), „Sprechlatein“ oder „Spontansprache“ (Lüdtke).l Der Einfachheit halber wird in dieser Arbeit jedoch der Begriff „Vulgärlatein“ verwendet, jedoch nicht ohne das Bewusstsein, wie vielschichtig sich dieser Terminus gestaltet.
Zunächst soll ein Überblick über die verschiedenen Definitionen und Theorien bezüglich des Charakters des Vulgärlatein gegeben werden. Hierzu werden die Konzepte bedeutender Romanisten kurz angerissen. Detaillierter wird auf den Ansatz des Strukturalisten Coseriu bezüglich regionaler, soziokultureller, stilistischer und chronologischer Differenzierungen des Vulgärlatein eingegangen. Eine weitere [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Begrifflichkeit des „Vulgärlatein“
- Ausgangspunkt: Abweichungen vom klassischen Latein
- Sich ändernde Auffassungen in linguistischer Theorie und Methodologie
- Vulgärlatein als „verderbte“ Form des klassischen Lateins
- Klassisches vs. zeitlich und sozial unterschiedenes Vulgärlatein
- Latein als System von Isoglossen
- Mündlichkeit und Schriftlichkeit in sprachtheoretischer Sicht
- Konzeption und Medium
- Parameter konzeptioneller Schriftlichkeit/Mündlichkeit
- Sprache der Distanz und Sprache der Nähe
- Texte mit konzeptioneller Mündlichkeit
- Texte von wenig gebildeten Autoren in einer Diglossie-Situation
- Bewusst informelle, umgangssprachlich gehaltene Texte
- An die linguistische Kompetenz der Rezipienten angepasste Texte
- Eklektizistische Mündlichkeit als Stilmittel
- Die Frage nach der Einheitlichkeit des Vulgärlateins
- Chronologische Faktoren
- Die chronologischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Kolonisierungen
- Das zeitlose System der rekonstruierten Formen
- Konservation und Innovation von Sprache
- Diatopische Faktoren: die dialektalen und regionalen Unterschiede in Italien
- Diastratisch-soziokulturelle Faktoren: Die besondere Form des sich außerhalb Italiens durchsetzenden Lateins
- Diaphasische Faktoren: Die Uneinheitlichkeit des literarischen Lateins
- Die Subsysteme des Vulgärlateins
- Chronologische Faktoren
- Die historisch/politisch bedingte Bildung von Sprachgrenzen
- Die Dezentralisierung des Römischen Reiches
- Gebietsverluste und Druck auf die Grenzen
- Der Einfluss der Germanen
- Die Entwicklung des Vulgärlateins zu den romanischen Schriftsprachen
- Die Situation der Diglossie
- Die Aufhebung der Diglossie als Entstehungsgrund der romanischen Schriftsprachen
- Äußere Faktoren
- Innere Faktoren
- Das Bedürfnis der schriftlichen Fixierung von Gesprochenem
- Endbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des Vulgärlateins im Kontext seiner Entstehung, Entwicklung und Bedeutung für die Entstehung der romanischen Sprachen. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Definitionen und Theorien des Vulgärlateins, analysiert die Rolle von konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit sowie die Auswirkungen politischer und historischer Ereignisse auf die Bildung von Sprachgrenzen.
- Definition und Theorien des Vulgärlateins
- Konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- Die Einheitlichkeit des Vulgärlateins und die Rolle von diatopischen, diastratischen und diaphasischen Faktoren
- Die Entstehung von Sprachgrenzen im Römischen Reich
- Die Entwicklung des Vulgärlateins zu den romanischen Schriftsprachen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Grundfrage nach dem Ursprung der romanischen Sprachen und die Bedeutung des Vulgärlateins für deren Entwicklung dar. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Begrifflichkeit des Vulgärlateins, beleuchtet verschiedene Definitionen und Theorien und analysiert die sich ändernden Auffassungen in linguistischer Theorie und Methodologie. Das dritte Kapitel widmet sich dem Thema Mündlichkeit und Schriftlichkeit in sprachtheoretischer Sicht und untersucht die verschiedenen Parameter konzeptioneller Schriftlichkeit/Mündlichkeit.
Das vierte Kapitel analysiert die Frage nach der Einheitlichkeit des Vulgärlateins, wobei chronologische, diatopische, diastratisch-soziokulturelle und diaphasische Faktoren betrachtet werden. Das fünfte Kapitel beleuchtet die historisch/politisch bedingte Bildung von Sprachgrenzen im Kontext der Dezentralisierung des Römischen Reiches und des Einflusses der Germanen.
Schließlich widmet sich das sechste Kapitel der Entwicklung des Vulgärlateins zu den romanischen Schriftsprachen und betrachtet die Rolle der Diglossie und deren Aufhebung in diesem Prozess.
Schlüsselwörter
Vulgärlatein, Romanische Sprachen, Sprachgeschichte, Sprachtheorie, konzeptionelle Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Diglossie, Sprachgrenzen, Romanistik, Sprachwandel
- Quote paper
- Silke Nufer (Author), 2003, Die Charakteristika von Vulgärlatein in definitorischem, sprachtheoretischem und historischem Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/35993