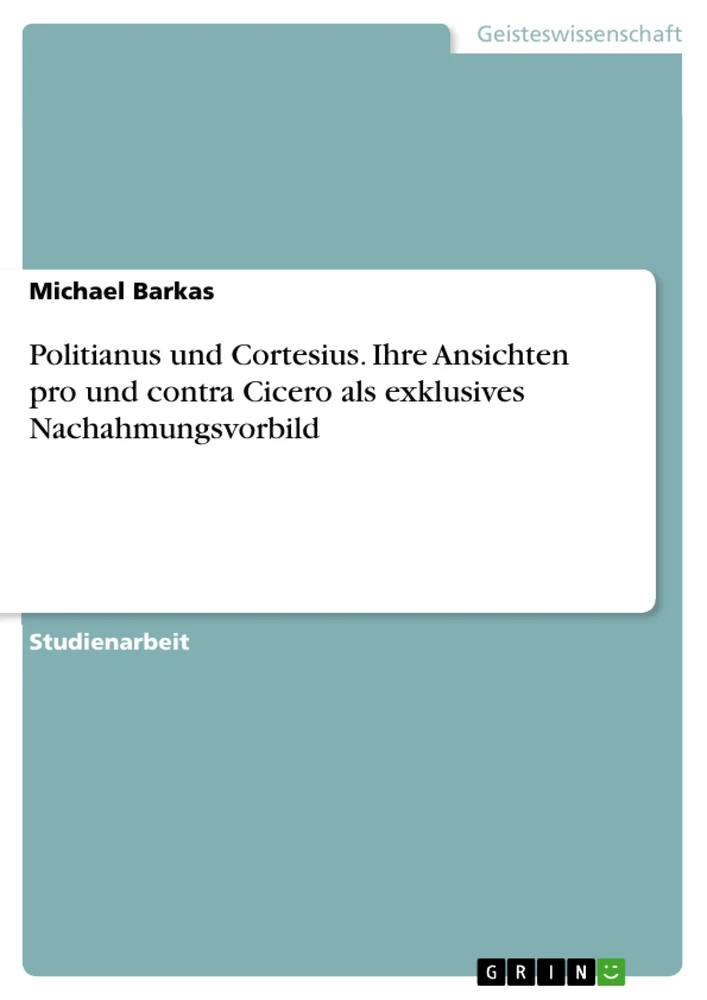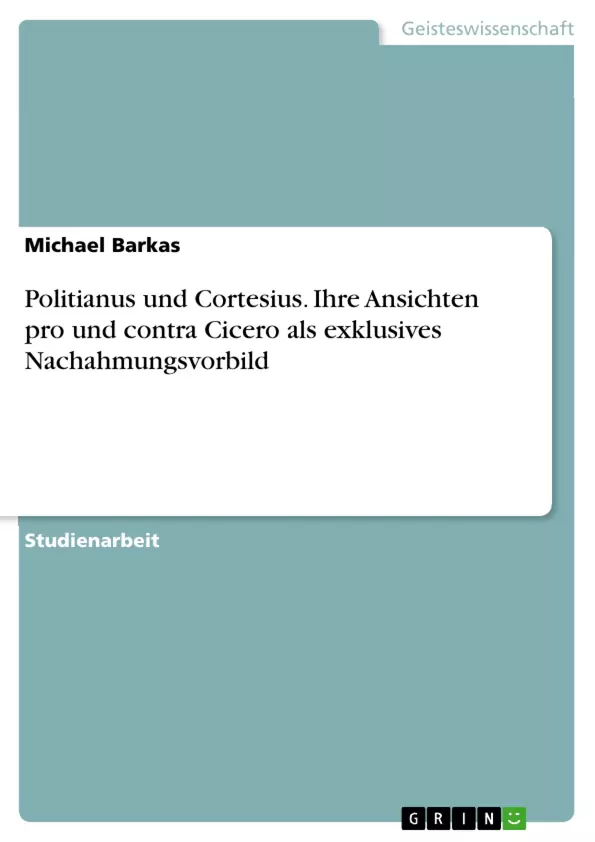Dieser Aufsatz analysiert die Ansichten von Cortesius und Politianus nach einer Argumentation für und wider Cicero als exklusives Nachahmungsvorbild und wie sich diese Punkte durch ihre zwei bekanntesten Briefe ergeben. Dazu werden mögliche Fakten vorgestellt, die einen sozialen Eindruck, Ciceros Wichtigkeit und manche sprachbezogenen humanistischen Ziele in der Italienischen Gesellschaft des 15. Jahrhunderts skizzieren.
Während des 14.-16. Jahrhunderts in Florenz in der Zeit des Renaissance-Humanismus, dessen Beginn dem gesamten bildungsinhaltlichen Erneuerungsplan von Humanisten wie Francesco Petrarca zugeschrieben werden kann, blühte innerhalb des Gelehrtenkreises eine Bewunderung und Hingabe an die klassische Antike auf. Ihr Programm zielte darauf ab, die ganze Gesellschaft durch eine Sprach- und Bildungsreform wie auch durch frische philosophische und theologische Ideen zur Erneuerung zu bewegen. Gleichzeitig setzte die immer noch existente, traditionelle Verbindung mit der ruhmvollen Vergangenheit des Römischen Reichs und generell den Tugenden der inspirierenden klassischen Antike eine bewusstere qualitative Suche nach den berühmtesten und geeignetsten Geistern ein. Diese sollten als Vorbilder und Ideale dienen können, um die humanistische Krise, die das Mittelalter gebracht hatte, zu überholen. Der Rückblick darauf brachte außer der kulturellen Bedeutung des antiken Roms und Griechenlands auch Cicero, den redegewandtesten Menschen, der je gelebt hatte, zurück. Zudem förderte er die Idee einer literarischen Bildung, die zuversichtlich durch die Nachahmung („imitatio“) seines Stils realisiert werden würde.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Wider Cicero: Politianus der Eklektiker
- Hintergrund
- Der Brief an Cortesius
- Für Cicero: Cortesius der Ciceronianer
- Hintergrund
- Der Brief an Politianus
- Überlegungen über die zwei Ansichten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Kontroverse um Cicero als ausschließliches Stilmodell während der Renaissance-Humanismus in Florenz. Sie analysiert die gegensätzlichen Ansichten von Angelus Politianus und Paulus Cortesius, die beide wichtige Persönlichkeiten der Humanismusbewegung waren. Die Arbeit zeichnet nach, wie sich Politianus als Vertreter des Eklektizismus gegen Cicero positioniert, während Cortesius für die Tradition des Ciceronianismus plädiert.
- Die Rolle von Cicero als Stilvorbild im Renaissance-Humanismus
- Die Debatte zwischen Eklektizismus und Ciceronianismus
- Die Bedeutung der Sprachreform für die Erneuerung der Gesellschaft
- Die sprachlichen und stilistischen Präferenzen von Politianus und Cortesius
- Der Einfluss von Cicero auf die italienische Gesellschaft des 15. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung führt in die Debatte um Cicero als Stilmodell im Rahmen des Renaissance-Humanismus ein und skizziert den historischen Kontext. Sie stellt die beiden Hauptfiguren der Arbeit, Angelus Politianus und Paulus Cortesius, sowie ihre unterschiedlichen Positionen vor.
- Wider Cicero: Politianus der Eklektiker: Dieses Kapitel beleuchtet Politianus' Kritik an Cicero als exklusivem Stilvorbild und seinen eigenen Eklektizismus, der sich durch eine freie und vielfältige Sprachverwendung auszeichnet. Es analysiert Politianus' literarisches Werk und zeigt die Gründe für seinen abweichenden Standpunkt.
- Für Cicero: Cortesius der Ciceronianer: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Cortesius' Verteidigung des traditionellen Ciceronianismus und seine Argumentation für Cicero als obersten Autor. Es untersucht Cortesius' Position und seine Beweggründe für die Bewahrung der klassischen Sprache.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Ciceronianismus, Eklektizismus, Renaissance-Humanismus, Sprachreform, Stil, Sprache, Literatur, Latein, Politianus, Cortesius und die italienische Gesellschaft des 15. Jahrhunderts. Sie analysiert die Debatte um Cicero als Stilvorbild im Rahmen der Erneuerung der Gesellschaft und der geistigen Tradition der Antike.
- Quote paper
- Michael Barkas (Author), 2014, Politianus und Cortesius. Ihre Ansichten pro und contra Cicero als exklusives Nachahmungsvorbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/356151