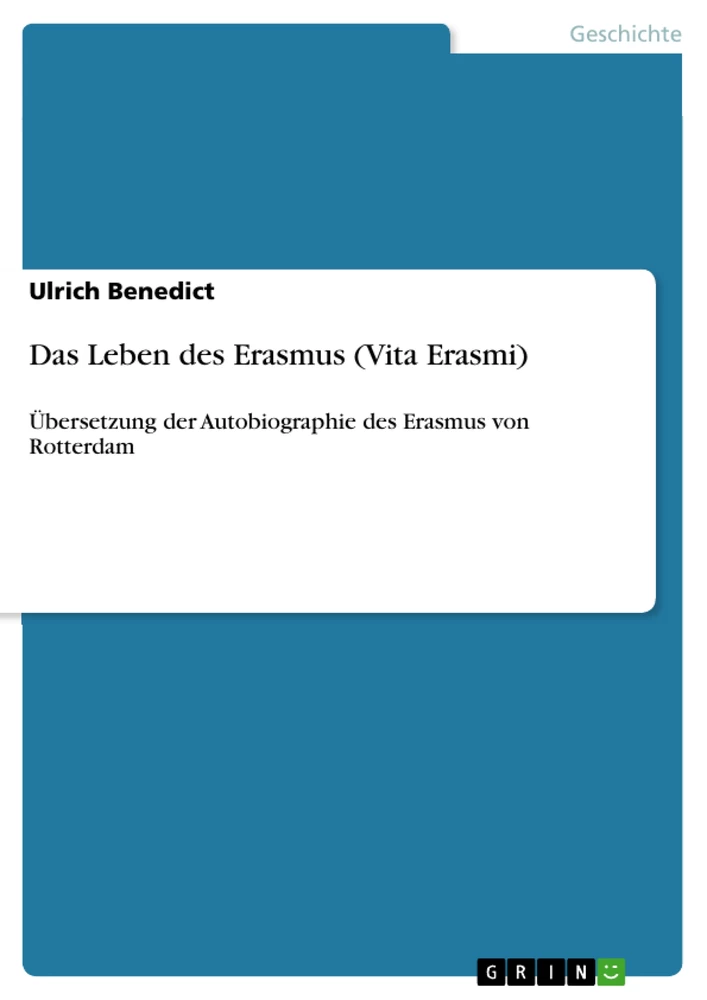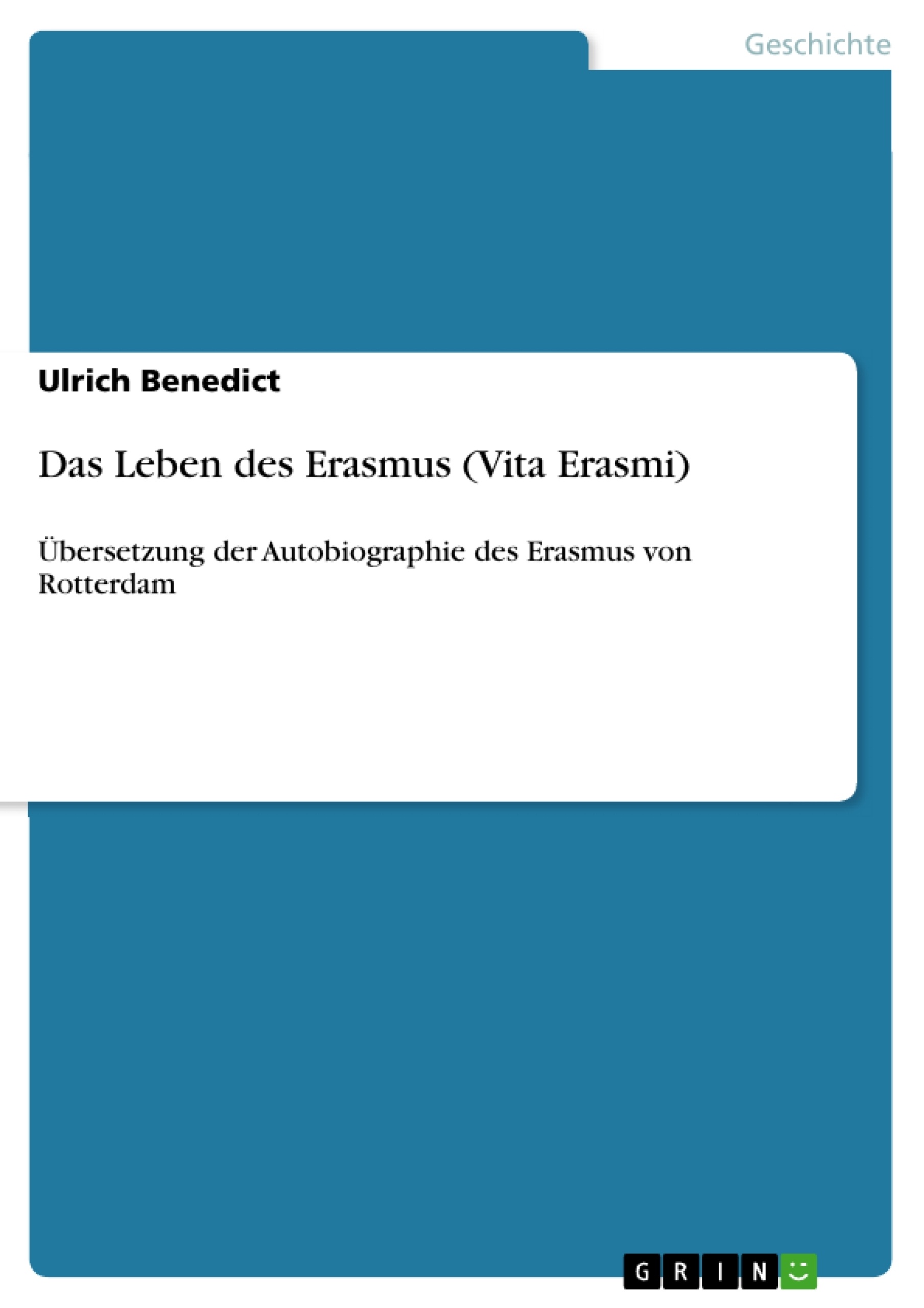Erasmus von Rotterdam hat im Alter von 57 oder 58 Jahren nach einer längeren Krankheit eine kleine Autobiographie über sein bisheriges Leben verfasst und an seinen Freund Goclen geschickt. Er hielt es für möglich, dass er nicht mehr lange leben würde und wollte mit dieser, in Latein verfassten, Autobiographie seine Lebensdaten für die Nachwelt hinterlassen.
Die Autobiographie gibt aufschlussreiche Details über seine Abstammung, seine Kindheit und Jugend, die von ihm besuchten Schulen, die Zeit seines Aufenthalts im Kloster, seine vielfältigen Tätigkeiten in anderen Staaten Europas und schließt mit einem kurzen Kapitel, in dem Erasmus sich selbst, seinen Charakter und seine Fähigkeiten einschätzt.
Der vorliegende Text ist die erste bekannte Übersetzung des lateinischen Urtextes ins Deutsche. Der Autor der Übersetzung gibt weitere Kommentare in einem Vorwort und in einer Schlussbemerkung.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- DAS LEBEN DES ERASMUS
- Geburt, Eltern und Grosseltern
- Kindheit und Jugend: die Schulen
- Kloster oder nicht?
- Aufbruch nach Europa
- Selbsteinschätzung
- SCHLUSSBEMERKUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Autobiographie von Erasmus von Rotterdam bietet einen Einblick in das Leben und die Denkweise des berühmten Humanisten. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts verfasst und beleuchtet die wichtigsten Stationen seiner Biografie, von der Geburt bis hin zur Selbstreflektion seiner eigenen Leistung.
- Die Bedeutung der Bildung und der humanistischen Ideale
- Die Herausforderungen und Chancen des Lebens in der frühen Neuzeit
- Erasmus' Verhältnis zu Kirche und Gesellschaft
- Die Entwicklung seiner eigenen Persönlichkeit und seines Selbstbildes
- Der Einfluss von Familie und Freunden auf seine Lebensentscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch beginnt mit der Schilderung von Erasmus' Geburt und seiner Familie. Es wird die schwierige Beziehung seines Vaters zu dessen Familie und die Flucht des Vaters vor der Heirat beschrieben. Die Kindheit und Jugend von Erasmus werden beleuchtet, wobei die Bedeutung der Bildung und die Rolle der Schulen für seine Entwicklung hervorgehoben werden. Die Frage nach einem möglichen Klosteraufenthalt wird thematisiert, bevor Erasmus' "Aufbruch nach Europa" und seine Selbstfindung im Mittelpunkt stehen. Die Autobiographie endet mit einer persönlichen Selbsteinschätzung von Erasmus.
Schlüsselwörter
Erasmus von Rotterdam, Autobiographie, Humanismus, Bildung, Kirche, Gesellschaft, Selbstbild, Familie, Freunde, frühe Neuzeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Vita Erasmi"?
Es ist eine kurze Autobiographie, die Erasmus von Rotterdam im Alter von etwa 57 Jahren verfasste, um seine Lebensdaten für die Nachwelt festzuhalten.
Welche Details erfährt man über Erasmus' Kindheit?
Die Autobiographie gibt Aufschluss über seine Abstammung, die schwierigen Familienverhältnisse seines Vaters und die Schulen, die er in seiner Jugend besuchte.
Wie stand Erasmus zu seinem Aufenthalt im Kloster?
Das Werk thematisiert die Zeit im Kloster und die spätere Entscheidung, dieses zu verlassen, um als Gelehrter durch Europa zu reisen.
Welche Selbsteinschätzung gibt Erasmus am Ende ab?
In einem kurzen Kapitel reflektiert er über seinen eigenen Charakter, seine intellektuellen Fähigkeiten und seine Rolle als Humanist.
In welcher Sprache wurde das Original verfasst?
Das Original wurde in Latein verfasst. Der vorliegende Text ist die erste bekannte Übersetzung dieses Urtextes ins Deutsche.
- Arbeit zitieren
- Ulrich Benedict (Autor:in), 2017, Das Leben des Erasmus (Vita Erasmi), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/356018