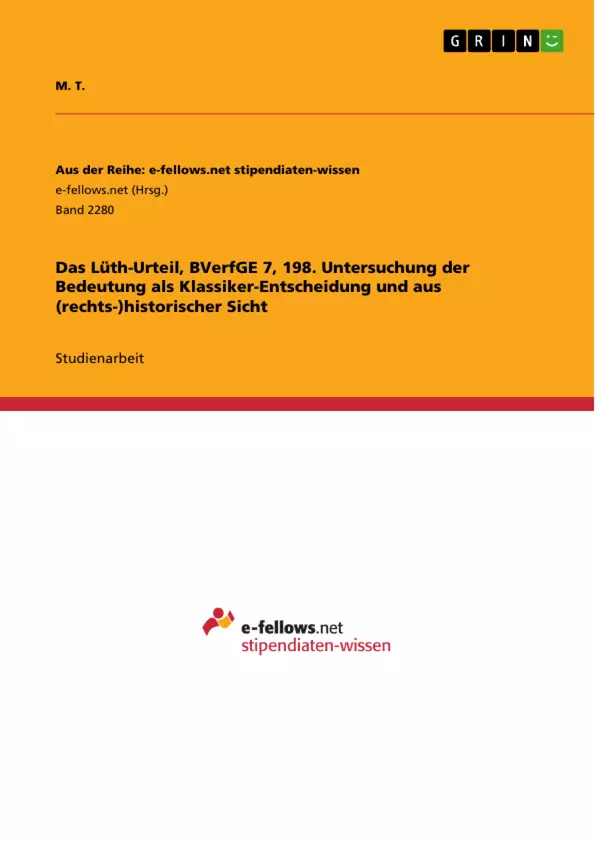Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es, anhand des Urteils die Gründe für die besondere Stellung der Meinungsfreiheit, die Entwicklung und die historischen Einflüsse herauszuarbeiten. Zunächst erfolgt eine Darstellung des Sachverhalts sowie der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Daran anschließend werden die Hauptproblematiken des Urteils und die heutige Bedeutung als Klassiker-Entscheidung untersucht. Dem Lüth-Urteil aus (rechts-)historischer Sicht und damit einhergehend den Besonderheiten des konkreten Sachverhalts widmet sich die Arbeit im darauffolgenden Teil. Abschließend werden die Rezeption in der Literatur und die Weiterentwicklung der Rechtsprechung in das Blickfeld genommen, bevor ein resümierendes Ergebnis bezüglich der im Verlauf dieser Arbeit herausgearbeiteten Erkenntnisse erzielt wird.
Bereits mit den Worten der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 – „un des droits les plus précieux de l’homme“ – wird die Meinungsfreiheit, verfassungsrechtlich verankert in Art. 5 I 1 1. Alt. GG, als eines der bedeutendsten Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet. Dabei leitete das Lüth-Urteil aus dem Jahr 1958 gewissermaßen als Fundamentalakt zentrale Weichenstellungen für die weitere Entwicklung der Reichweite und der Interpretation der Meinungsfreiheit ein. Im Wesentlichen beschäftigt sich das Urteil mit dem Umfang und Sinngehalt des Grundrechts der Meinungsfreiheit und fragt, inwieweit die Grundrechte auch im Privatrecht zu berück-sichtigen sind. Angesichts der herausragenden Bedeutung der Meinungsfreiheit innerhalb einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, insbesondere wegen der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhänge, die das Urteil herstellt und vor deren Hintergrund es interpretiert werden kann, ist es auch und gerade nach mehr als einem halben Jahrhundert seit Urteilsfindung interessant, die geschichtliche Entwicklung nachzuverfolgen sowie die historischen Umstände des Lüth-Urteils als Klassiker-Entscheidung zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung in die Thematik
- B. Analyse des Lüth-Urteils
- I. Darstellung des Sachverhalts und Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
- II. Hauptproblematiken des Urteils
- 1. Schutzbereich und Bedeutung der Meinungsfreiheit
- 2. Anwendbarkeit von Grundrechten im Verhältnis von Bürger zu Bürger?
- 3. Prüfungsumfang des Bundesverfassungsgerichts
- 4. Verhältnis von Art. 5 I 1 1. Alt. GG zu den Schranken des Art. 5 II GG
- 5. Fazit
- III. Heutige Bedeutung als „Klassiker“-Entscheidung
- IV. Das Lüth-Urteil aus (rechts-)historischer Sicht
- V. Rezeption in Literatur
- VI. Weiterentwicklung der Rechtsprechung
- C. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Lüth-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 7, 198), eine wegweisende Entscheidung im öffentlichen Recht. Ziel ist es, die Hauptproblematiken des Urteils, seine heutige Bedeutung und seine rechtshistorische Einordnung zu untersuchen sowie die Weiterentwicklung der Rechtsprechung in diesem Bereich zu beleuchten.
- Die Bedeutung der Meinungsfreiheit im Kontext des Lüth-Urteils
- Die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten
- Die Anwendbarkeit von Grundrechten im Verhältnis zwischen Bürgern
- Die Auslegung von Art. 5 GG (Meinungsfreiheit)
- Die historische Einordnung des Urteils im Kontext des Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung in die Thematik: Dieses Kapitel wird voraussichtlich eine allgemeine Einführung in die Thematik des Lüth-Urteils und seiner Bedeutung für das öffentliche Recht geben. Es wird den Kontext und die Relevanz des Urteils im deutschen Rechtssystem skizzieren und den Leser auf die detailliertere Analyse in den folgenden Kapiteln vorbereiten.
B. Analyse des Lüth-Urteils: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert das Lüth-Urteil in all seinen Facetten. Es wird den Sachverhalt darstellen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts detailliert erläutern. Die Hauptproblematiken, wie der Schutzbereich der Meinungsfreiheit, die Anwendbarkeit von Grundrechten im Verhältnis von Bürger zu Bürger und die Auslegung der Schranken der Meinungsfreiheit, werden im Detail behandelt. Die historische Perspektive und die Weiterentwicklung der Rechtsprechung werden ebenfalls beleuchtet.
C. Fazit: Dieses Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Kontext der Meinungsfreiheit und der Drittwirkung von Grundrechten. Es wird die Bedeutung des Lüth-Urteils als "Klassiker"-Entscheidung herausstellen und seine andauernde Relevanz für die aktuelle Rechtsprechung unterstreichen.
Schlüsselwörter
Lüth-Urteil, Bundesverfassungsgericht, Meinungsfreiheit, Grundrechte, mittelbare Drittwirkung, objektive Wertordnung, allgemeine Gesetze, Wechselwirkungslehre, Art. 5 GG, Rechtsgeschichte, Nationalsozialismus, Boykottrechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Analyse des Lüth-Urteils
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert das Lüth-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 7, 198), eine wegweisende Entscheidung im öffentlichen Recht. Der Fokus liegt auf den Hauptproblematiken des Urteils, seiner heutigen Bedeutung, seiner rechtshistorischen Einordnung und der Weiterentwicklung der Rechtsprechung in diesem Bereich.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Bedeutung der Meinungsfreiheit im Kontext des Lüth-Urteils, die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten, die Anwendbarkeit von Grundrechten im Verhältnis zwischen Bürgern, die Auslegung von Art. 5 GG (Meinungsfreiheit) und die historische Einordnung des Urteils im Kontext des Nationalsozialismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Einleitung, Analyse des Lüth-Urteils und Fazit. Die Analyse des Lüth-Urteils ist weiter unterteilt in die Darstellung des Sachverhalts und der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die Hauptproblematiken des Urteils (Schutzbereich der Meinungsfreiheit, Anwendbarkeit von Grundrechten im Verhältnis Bürger zu Bürger, Prüfungsumfang des BVerfG, Verhältnis von Art. 5 I 1 1. Alt. GG zu den Schranken des Art. 5 II GG), die heutige Bedeutung als „Klassiker“-Entscheidung, die rechtshistorische Sicht, die Rezeption in der Literatur und die Weiterentwicklung der Rechtsprechung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lüth-Urteil, Bundesverfassungsgericht, Meinungsfreiheit, Grundrechte, mittelbare Drittwirkung, objektive Wertordnung, allgemeine Gesetze, Wechselwirkungslehre, Art. 5 GG, Rechtsgeschichte, Nationalsozialismus, Boykottrechtsprechung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Hauptproblematiken des Lüth-Urteils zu untersuchen, seine heutige Bedeutung und seine rechtshistorische Einordnung zu beleuchten sowie die Weiterentwicklung der Rechtsprechung in diesem Bereich zu analysieren.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung bietet eine allgemeine Einführung in die Thematik des Lüth-Urteils und seine Bedeutung für das öffentliche Recht. Sie skizziert den Kontext und die Relevanz des Urteils im deutschen Rechtssystem.
Was ist der Kern der Arbeit?
Der Kern der Arbeit ist die detaillierte Analyse des Lüth-Urteils in all seinen Facetten, inklusive der Darstellung des Sachverhalts und der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sowie der eingehenden Behandlung der Hauptproblematiken.
Was beinhaltet das Fazit?
Das Fazit fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen, gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und unterstreicht die Bedeutung des Lüth-Urteils als "Klassiker"-Entscheidung und seine andauernde Relevanz für die aktuelle Rechtsprechung.
- Quote paper
- M. T. (Author), 2016, Das Lüth-Urteil, BVerfGE 7, 198. Untersuchung der Bedeutung als Klassiker-Entscheidung und aus (rechts-)historischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/355230