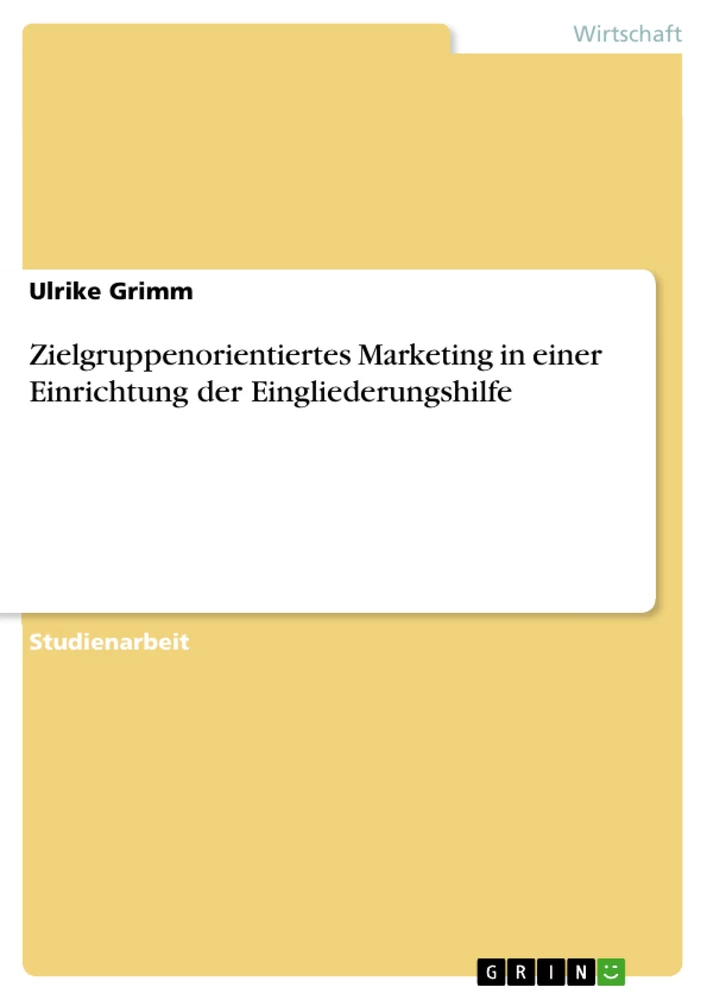Im Mittelpunkt der Arbeit stand der Gedanke „Am Ende der Planung muss ein für den Kunden verständliches Produkt, Angebot oder Projekt stehen“ (Gromberg, 2006). Ziel ist es daher, die Marketingmaßnahmen auf Menschen mit geistiger Behinderung strategisch auszurichten. Bestehende Prozesse können so im Sinne der Klienten optimiert und angepasst werden.
In der Einrichtung existiert bislang kein Marketingplan.
Im Rahmen der Arbeit wird ein Marketingplan erstellt. Dies bedeutet, dass zuerst eine Situationsanalyse vorgenommen wird, dann eine Bewertung der Situation. Nach der Festlegung der Ziele und der Strategie erfolgt die Festlegung der Maßnahmen und Instrumente im sogenannten Marketing-Mix. Im Weiteren wird die Umsetzung der ersten Maßnahmen reflektiert und diskutiert.
Die Arbeit geht kurz auf die unterstützte Kommunikation ein und setzt diese in Bezug zum Marketing.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel der Arbeit
- Vorgehensweise in der Arbeit
- Beschreibung der Einrichtung
- Situationsanalyse
- Zielgruppenanalyse inkl. Geografie
- Einrichtungsanalyse
- Umfeldanalyse
- Situationsbewertung
- Branchen- und Marktanalyse
- Wettbewerbsanalyse
- Zielsetzung
- Strategie/ strategische Marketingplanung
- Segmentierungsstrategie
- Leistungsfeldstrategie
- Beeinflussungsstrategie
- Gebietsstrategie
- Maßnahmen und Instrumente - der Marketingmix
- Leistungspolitik
- Finanzierungspolitik
- Kommunikationspolitik
- Situationsanalyse
- Kommunikationsziele
- Zielgruppenplanung
- Kommunikationsstrategie
- Kommunikationsbudget
- Kommunikationsinstrumente
- Maßnahmenplanung
- Distributionspolitik
- Realisierung erster Maßnahmen
- Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Marketingplans für eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, die Menschen mit geistiger Behinderung betreut. Das Ziel ist es, die Einrichtung auf die Teilhabe am Leben in der Gemeinde auszurichten und die Marketingmaßnahmen strategisch auf die Bedürfnisse der Klienten zu fokussieren. Dadurch sollen bestehende Prozesse optimiert und die Effizienz der Einrichtung gesteigert werden.
- Analyse der Zielgruppe und deren Bedürfnisse
- Entwicklung einer Marketingstrategie für die Einrichtung
- Definition von Maßnahmen und Instrumenten des Marketing-Mix
- Realisierung und Evaluation erster Marketingmaßnahmen
- Steigerung der Effizienz der Einrichtung durch Kundenorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Sozialmarketings ein und definiert die Zielsetzung der Arbeit. In Kapitel 2 wird die Einrichtung der Eingliederungshilfe vorgestellt. Kapitel 3 beinhaltet eine umfassende Situationsanalyse, die die Zielgruppe, die Einrichtung selbst, das Umfeld und den Wettbewerb betrachtet. Kapitel 4 legt die Zielsetzung des Marketingplans fest. Kapitel 5 befasst sich mit der strategischen Marketingplanung, einschließlich der Segmentierung, Leistungsfeld-, Beeinflussungs- und Gebietsstrategie. In Kapitel 6 werden Maßnahmen und Instrumente des Marketing-Mix, wie Leistungspolitik, Finanzierungspolitik, Kommunikationspolitik und Distributionspolitik, vorgestellt. Kapitel 7 beschreibt die Realisierung erster Marketingmaßnahmen. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Zielgruppenorientiertes Marketing, Eingliederungshilfe, Menschen mit geistiger Behinderung, Teilhabe, Sozialmarketing, Situationsanalyse, Marketingstrategie, Marketing-Mix, Effizienzsteigerung.
- Quote paper
- Ulrike Grimm (Author), 2016, Zielgruppenorientiertes Marketing in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/354366