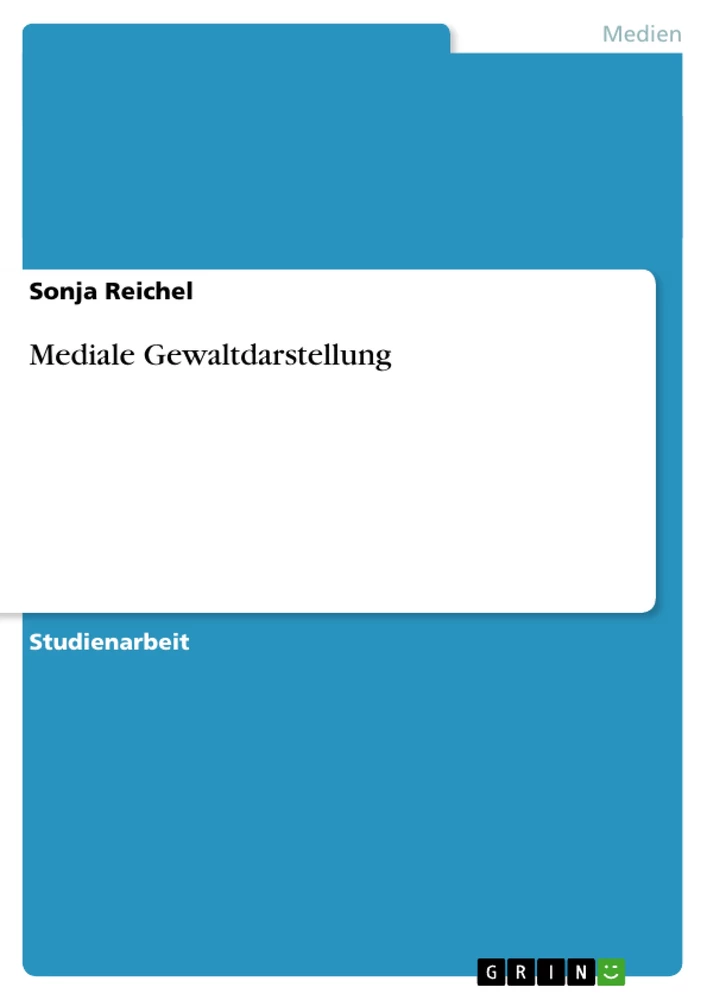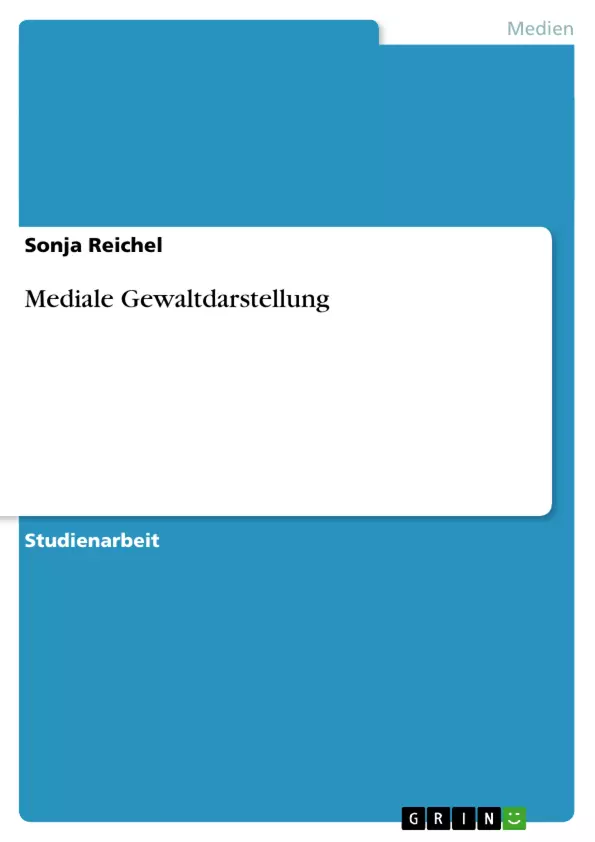Mediengewalt ist in der Öffentlichkeit ein Thema von großem Interesse, bei dem zumeist alle selbsternannten Experten von Jung bis Alt einer Meinung sind: es wird im Alltagsleben davon ausgegangen, dass gewalttätige Filme bei Heranwachsenden die Gewaltbilligung und die Bereitschaft, Gewalt auszuüben, erhöhen. 1 So wurde auch nach Gewaltakten an Schulen wie beispielsweise 1999 in Metten/Niederbayern verstärkt nach gewaltverherrlichenden und gewaltdarstellenden Medien im Besitz des Täters gesucht und auch entsprechendes Material gefunden in Form von CD-ROMs und Videokassetten. Diese wurden dann zusammen mit Waffen und Gesichtsmasken als »Tatwerkzeuge« abfotografiert. Dafür, dass es sich bei den Videos aber beispielsweise um pornographische Filme handelte die als Tatvorlage eher ungeeignet erscheinen interessierte sich in dem aufgeheizten Klima niemand, die Schuld der Medien galt als bewiesen. 2 So einheitlich wie die Meinung der Laien ist die der Wissenschaftler auf dem Gebiet der Mediengewalt allerdings nicht. Für keine Thematik der Medienwirkungsforschung liegen mehr Veröffentlichungen vor als für mediale Gewaltdarstellung, wobei diese Menge an Studien noch nichts über die Qualität ihrer Inhalte aussagt.3 Im Folgenden soll nach Definition einiger relevanter Begriffe die Gewaltdarstellungen in medialen Kontexten und Charakteristika der Fernsehgewalt geschildert werden. Anschließend wird auf einige wichtige Thesen zur Thematik der medialen Gewaltdarstellung eingegangen, um den derzeitigen Stand der Medienwirkungsforschung auf diesem Gebiet widerzuspiegeln. 1 vgl. Kunczik, M. und Zipfel, A. (2003): Medien und Gewalt – Auseinandersetzug mit der Medienwirkungsforschung. In: Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg (Hrsg.):Gewalt in den Medien-Ein Thema für die Elternarbeit. Stuttgart, S.110 (Im Folgenden zitiert als:
Kunczik und Zipfel, 2003) 2 vgl. Nagl, M. (2003): Öffentliche Erregung: Historische und aktuelle Aspekte medialer Gewaltdarstellung. In: Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Gewalt in den Medien-Ein Thema für die Elternarbeit. Stuttgart, S.110 (Im Folgenden zitiert als: Nagl, 2003) 3 vgl. Kunczik und Zipfel, 2003, S.110
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Definition von Gewalt
- Definition von Medien
- Der Gewaltbegriff in medialen Kontexten
- Informationssendungen
- Unterhaltungssendungen
- Reality TV
- Charakteristika der Fernsehgewalt
- Wirkung von Gewalt in den Medien
- Die Katharsisthese
- Die Habitualisierungsthese
- Die Suggestionsthese
- Die Stimulationsthese
- Die Lerntheorie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Darstellung von Gewalt in den Medien und deren mögliche Auswirkungen auf die Rezipienten. Dabei wird insbesondere die Rolle des Fernsehens als Medium der Gewaltvermittlung beleuchtet.
- Definition von Gewalt im medialen Kontext
- Charakteristika der Fernsehgewalt
- Theorien zur Wirkung von Mediengewalt
- Die Katharsisthese
- Die Lerntheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der medialen Gewaltdarstellung ein und zeigt die Relevanz des Themas für die öffentliche Diskussion auf. Das Kapitel „Definitionen“ beleuchtet den Begriff der Gewalt und den Medienbegriff im Kontext der Arbeit. Das Kapitel „Der Gewaltbegriff in medialen Kontexten“ analysiert verschiedene mediale Kontexte, in denen Gewalt dargestellt wird, insbesondere im Fernsehen.
Das Kapitel „Wirkung von Gewalt in den Medien“ stellt wichtige Theorien zur Wirkung von Mediengewalt vor, darunter die Katharsisthese, die Habitualisierungsthese, die Suggestionsthese, die Stimulationsthese und die Lerntheorie.
Schlüsselwörter
Mediengewalt, Fernsehgewalt, Katharsisthese, Habitualisierungsthese, Suggestionsthese, Stimulationsthese, Lerntheorie, Wirkungsforschung, Rezeption.
- Quote paper
- Sonja Reichel (Author), 2004, Mediale Gewaltdarstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/35409