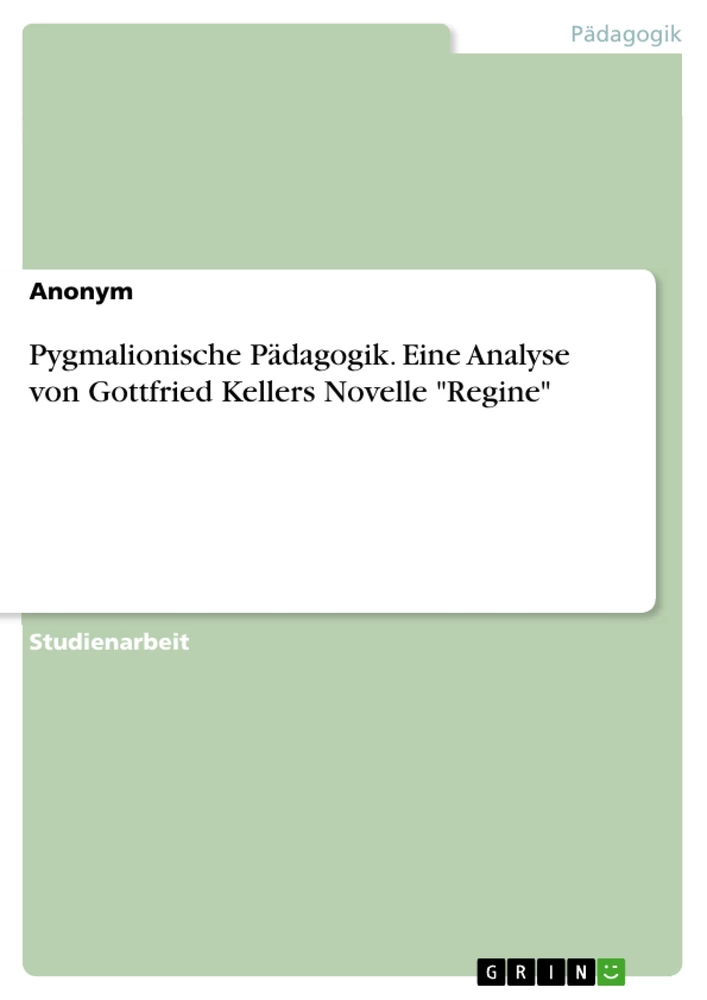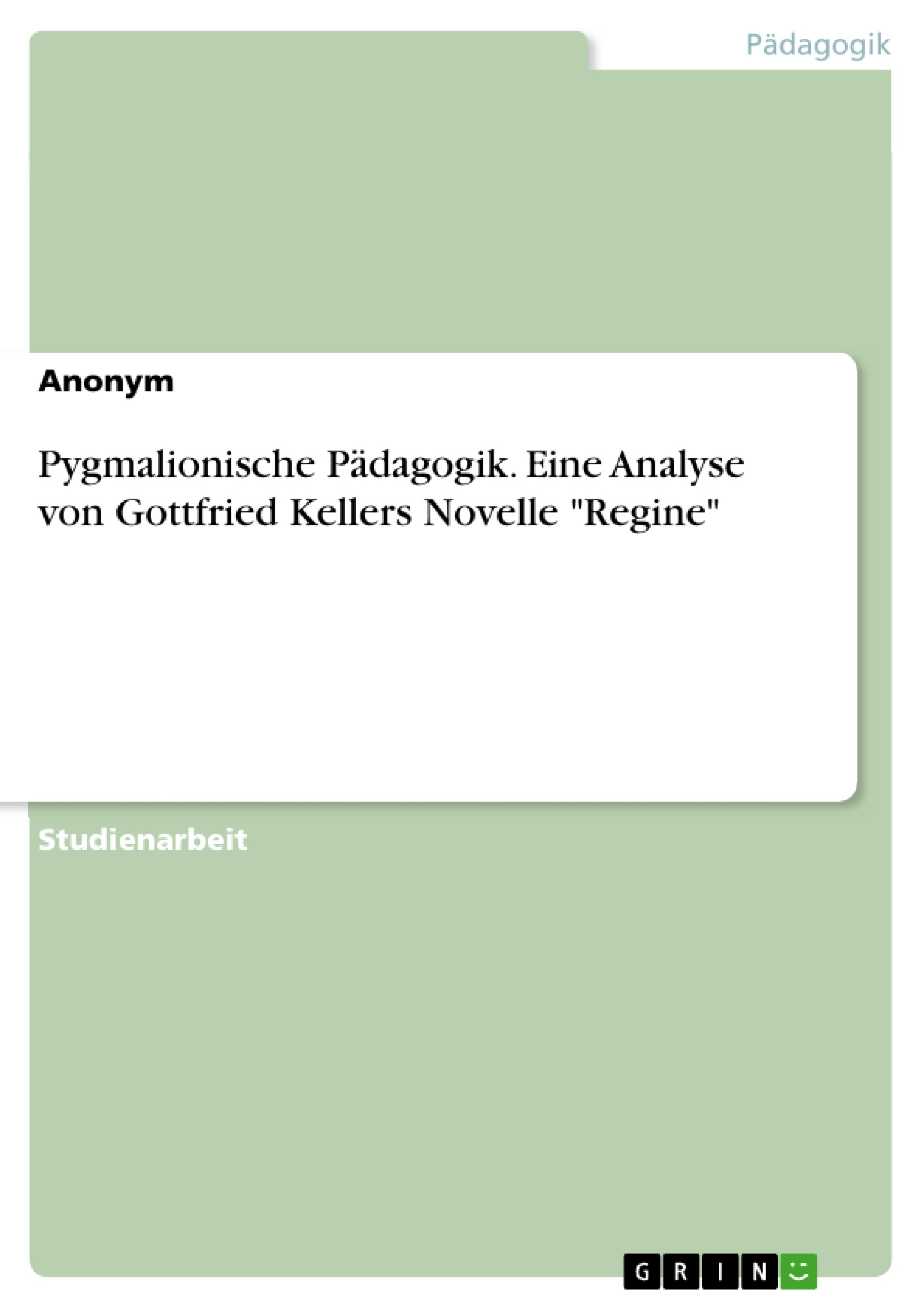Ovids "Pygmalion", dessen Geschichte in seinen Metamorphosen beschrieben wird, kann als Urquelle des Pygmalionstoffes angesehen werden. Der Bildhauer Pygmalion erschafft eine perfekte Statue, die er mit Hilfe der Göttin Venus zum Leben erweckt. Er gestaltet diese als Idealbild einer Frau, nachdem er im wahren Leben nach Enttäuschungen dem weiblichen Geschlecht abgeschworen hat. Dieser Stoff wird in unzähligen Variationen immer wieder neu in der Literatur bearbeitet und verarbeitet.
Nach dem Ende der Kunstperiode durch die Kritik Heines und Büchners ausgelöst, kommt es zur entscheidenden Akzentverschiebung. Jetzt rückt die Statue in den Mittelpunkt und löst den geniehaften schaffenden Künstler ab. Somit kommt es im Realismus zu einer neuen literarturgeschichtlichen Beleuchtung des Pygmalionstoffes. An dieser neuen Debatte beteiligen sich Immermann, Ebner-Eschenbach und Fontane. Eine besondere Beachtung soll in dieser Arbeit Kellers Novelle "Regine" genießen. An ihr soll „pygmalionische Pädagogik“ deutlich gemacht werden. Weiser spricht in diesem Zusammenhang von einem „[…] pädagogisch ambitioniertem Pygmalion […]“ (Weiser 1998, 131). Um die Verschiebung des Pygmalionstoffes aufzeigen zu können, wird Kellers Regine im Folgenden mit dem Ovid‘schen Ursprungstext verglichen.
Zu Beginn dieser Arbeit wird die Epoche des Realismus vorgestellt und die Bedeutung der Novelle als herausragende Gattung im Realismus beschrieben. Im Anschluss soll der reale Bezug zu der Figur „Regine“ erklärt werden. In einem anschließenden Exkurs werden etymologische Erklärungen zu „Bilden und Erziehen“ aufgezeigt. In konkreter Textarbeit anhand der Novelle Regine sollen sowohl die Anbahnung der Katastrophe, die Auflösung des Pygmalionmotives, sowie die Bedeutung der gescheiterten Kommunikation zwischen Regine und Erwin analysiert werden. Der Schlussteil dieser Arbeit bietet sowohl eine Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse, als auch einen Ausblick, inwieweit sich der Pygmalionstoff bei Shaw weiterentwickelt wird.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Novelle als typische Gattung im Realismus...
- 3. Hintergrundinformationen zu Kellers Regine
- 3.1 Entstehungsgeschichte
- 3.2 Inhaltsangabe von Regine.
- 4. Etymologische Überlegung zu Bilden und Erziehen
- 5. "Pygmalionische Erziehung“ in Kellers Regine
- 5.1 Anbahnung der Katastrophe..
- 5.2 Auflösung des Pygmalionmythos.
- 5.3 Gescheiterte Kommunikation....
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
- 7. Literaturangaben.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser Hausarbeit ist es, das Konzept der „pygmalionischen Pädagogik“ am Beispiel von Gottfried Kellers Novelle „Regine“ zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die literarische Tradition des Pygmalion-Stoffes und seine Umdeutung im Realismus, insbesondere im Kontext von Kellers Werk.
- Entwicklung des Pygmalion-Stoffes in der Literaturgeschichte
- Die Rolle der Novelle im Realismus
- Etymologische Analyse von „Bilden und Erziehen“
- Analyse der „pygmalionischen Erziehung“ in Kellers „Regine“
- Gescheiterte Kommunikation als zentraler Aspekt der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema „Pygmalionische Pädagogik“ ein und erläutert den historischen Hintergrund des Pygmalion-Stoffes, der aus Ovids „Metamorphosen“ stammt. Die Arbeit zeigt die Entwicklung des Stoffes im Laufe der Literaturgeschichte auf, wobei sie insbesondere die Bedeutung der Novelle im Realismus hervorhebt.
Das zweite Kapitel analysiert die Novelle als typische Gattung im Realismus und beschreibt die soziokulturellen Veränderungen, die die Entwicklung dieser Gattung beeinflusst haben. Es wird auf die Bedeutung der Rahmen- und Binnenerzählung sowie auf die detailgetreue Wiedergabe der Wirklichkeit hingewiesen.
Im dritten Kapitel werden Hintergrundinformationen zu Kellers „Regine“ präsentiert, darunter die Entstehungsgeschichte der Novelle und die reale Vorlage für die Hauptfigur. Das Kapitel erläutert die Einbettung der Novelle in Kellers „Sinngedicht“ und die Thematik der glücklichen oder unglücklichen Liebeswahl, die in den einzelnen Novellen des Zyklus thematisiert wird.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Pygmalion-Stoff, Pädagogik, Novelle, Realismus, Gottfried Keller, „Regine“, Entstehungsgeschichte, Liebe, Kommunikation, gescheiterte Kommunikation, Anbahnung der Katastrophe, Auflösung des Pygmalionmythos.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Pygmalionische Pädagogik. Eine Analyse von Gottfried Kellers Novelle "Regine", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/353542