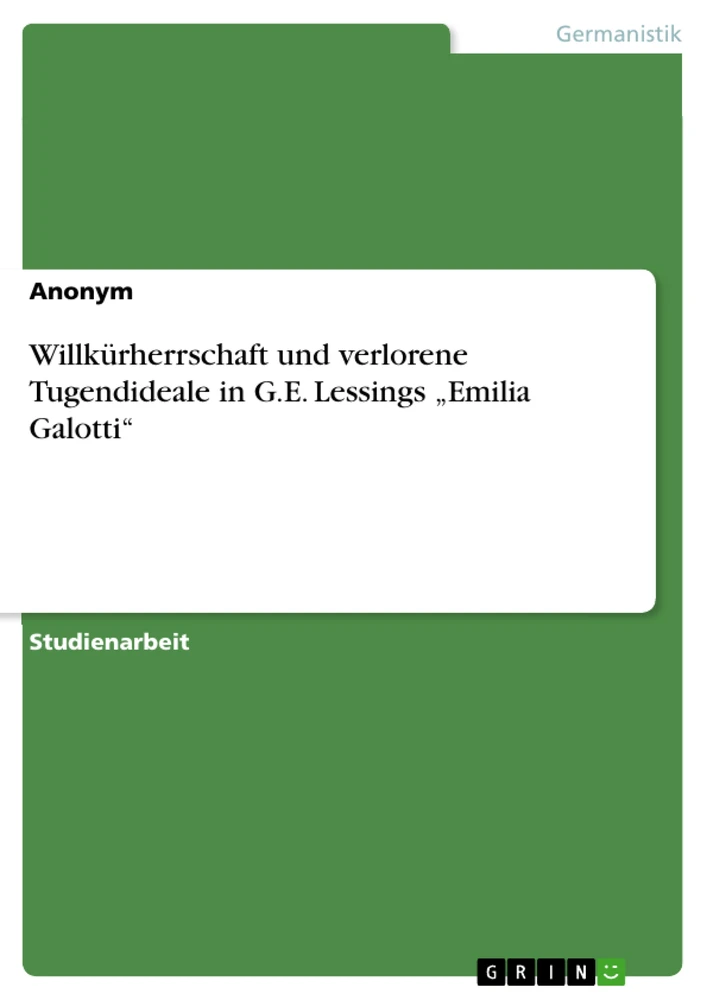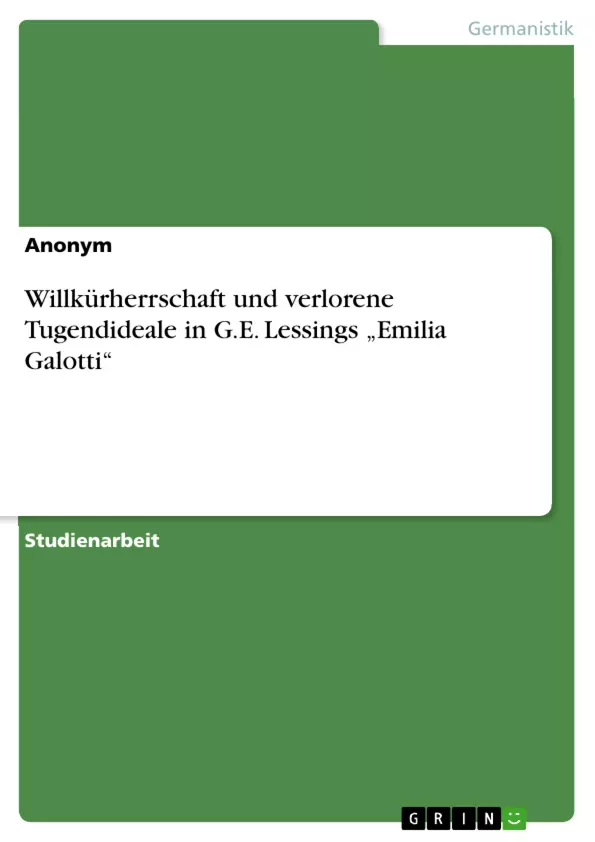Wie konnte es dazu kommen, dass die junge Emilia, welche wenige Augenblicke zuvor noch von ihrer eigenen Hochzeit zu träumen vermag, sich schließlich für den eigenen Tod entscheidet? Wer trägt an der aussichtslosen Situation, in der sich die junge Frau wiederzufinden glaubt, letztlich die Schuld? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die vorliegende Hausarbeit, deren Basis das im März 1772 im Herzoglichen Opernhaus in Braunschweig uraufgeführte bürgerliche Trauerspiel „Emilia Galotti“ darstellt, welches auf den Vergina-Stoff der römischen Geschichte des Titus Livius zurückzuführen ist und erstmals den Ständekonflikt im Kontext der bürgerlichen Mentalität konkret thematisiert.
Im Fokus der Arbeit des weiblich titulierten Trauerspiels stehen jedoch die vorherrschend männlichen Protagonisten: Hettore Gonzaga, Prinz von Gustalla sowie Familienoberhaupt Odoardo Galotti. Mittels ausgewählter Textpassagen sollen zunächst grundsätzliche Charaktereigenschaften anhand ihrer Taten, Einstellungen und Personeninteraktionen herausgestellt und beschrieben werden, um dann ihre Auswirkungen in Abhängigkeit ihres gesellschaftlichen Ranges darzulegen. Durch die Handlungsweisen Odoardos und Hettores wird somit geklärt, ob ihnen eine Mitschuld hinsichtlich der Selbstentleibung des Mädchens zuzuweisen wäre und diese schlussendlich zu einer möglichen Beantwortung der Frage „Warum musste Emilia Galotti sterben?“ beiträgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Hettore Gonzagas, Souverän und Liebhaber
- 2.2 Die Unvereinbarkeit von fürstlicher Macht und Empfindsamkeit
- 2.3 Tugendheld Odoardo als Oberhaupt der Familie Galotti und als sorgender Vater
- 2.4 Rachephantasien, erzwungene Ruhe und Machtlosigkeit eines tugendhaften Helden
- 3. Die Schuldfrage an Emilias Freitod
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das bürgerliche Trauerspiel „Emilia Galotti“ von Gotthold Ephraim Lessing, um die Frage nach der Schuld am Freitod der Protagonistin zu beleuchten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den männlichen Figuren Hettore Gonzaga und Odoardo Galotti sowie deren Handlungen und Entscheidungen im Kontext ihrer gesellschaftlichen Rollen.
- Der Konflikt zwischen fürstlicher Macht und bürgerlicher Tugend
- Die Rolle von Liebe, Leidenschaft und Willkür in der Entscheidungsprozesse der Figuren
- Die Darstellung von familiären Strukturen und sozialen Normen im 18. Jahrhundert
- Die gesellschaftliche Ungleichheit und deren Einfluss auf die Handlung des Stücks
- Die Frage der Verantwortung und Schuld im Kontext der Tragödie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext des Stücks und die Forschungsfrage einführt. Im Hauptteil werden die Charaktere Hettore Gonzaga und Odoardo Galotti anhand ihrer Handlungen und Einstellungen näher beleuchtet. Hettore Gonzaga wird als Herrscher und Liebhaber dargestellt, dessen Willkür und Leidenschaft ihn von seinen Pflichten ablenken. Odoardo Galotti hingegen wird als tugendhafter Vater und Familienoberhaupt beschrieben, der mit den Machenschaften des Fürsten zu kämpfen hat. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Analyse der Entscheidungsprozesse beider Figuren und deren Auswirkungen auf die Tragödie. Der letzte Teil der Arbeit befasst sich mit der Schuldfrage am Freitod Emilias.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den Themen der Willkürherrschaft, verlorene Tugendideale, Ständekonflikt, bürgerliches Trauerspiel, Empfindsamkeit, Liebe, Leidenschaft, Macht, Familie, Verantwortung und Schuld im Kontext von Gotthold Ephraim Lessings „Emilia Galotti“.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Willkürherrschaft und verlorene Tugendideale in G.E. Lessings „Emilia Galotti“, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/353395