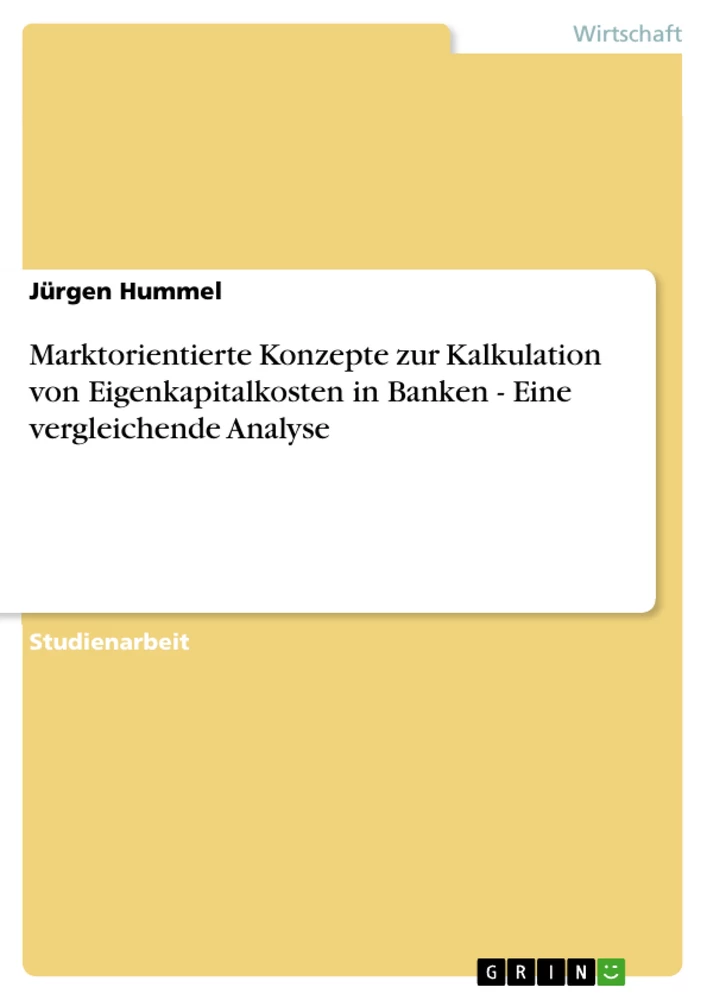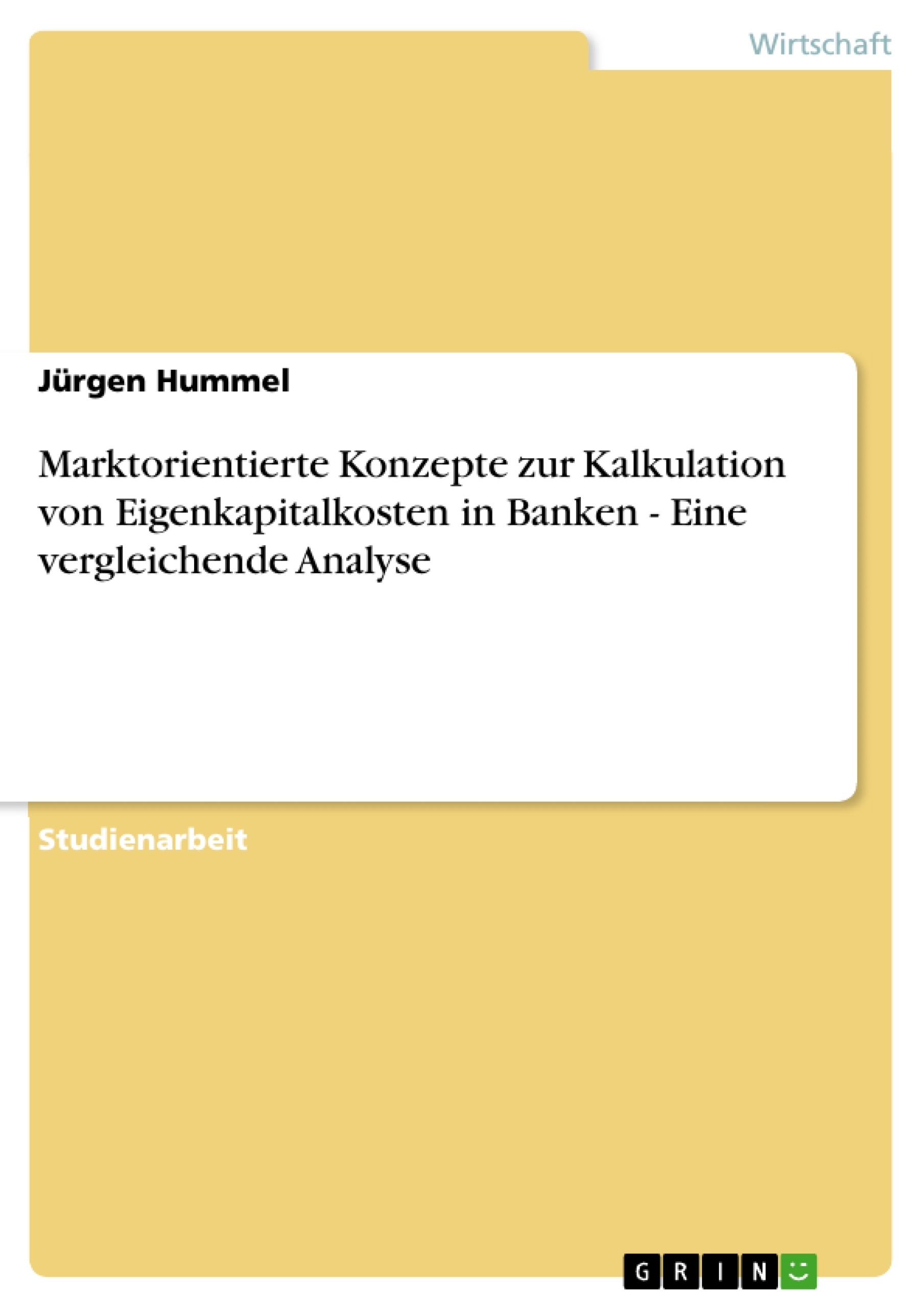Einleitung
Der seit den achtziger Jahren sich vollziehende Strukturwechsel im internationalen Bankgeschäft hat deutliche Auswirkungen auf den Bankensektor. Nie zuvor waren die Kreditinstitute so sehr gezwungen, sich an den Bedürfnissen ihrer Kapitalgeber und Kunden auszurichten wie heute. War es früher noch üblich, die Geschäftsausweitung als primäres Ziel einer Bank anzusehen, wird heute zunehmend die Ertragsorientierung, unter besonderer Berücksichtigung des Risikos, in den Vordergrund gestellt. Der sich verstärkende Wettbewerb, sowohl auf der Kapital- als auch auf der Kundenseite, ist deutlich sichtbar und auf eine Vielzahl von Gründen zurückzuführen. Die Wichtigsten sind dabei die Globalisierung und die Deregulierung der Finanzmärkte in den letzten Jahren. Die immer noch zunehmende Verbindung der nationalen Märkte zu einem weltumspannenden Verbund von Handelsplätzen wurde vor allem durch die fortgeschrittene Technologie der jüngsten Zeit möglich. Der Abbau behördlicher Beschränkungen führte ebenfalls zu einem wahren ,,Kampf" um das Kapital. Dies aber nicht nur unter den inländischen Instituten, sondern auch mit den nun zunehmend in den Markt drängenden ausländischen Banken, sowie neuartigen Finanzintermediären, wie z. B. Direktbanken, oder Onlinebrokern. Nicht zuletzt hat auch im Sparkassen- und Genossenschaftssektor, durch die in den letzten Jahren beobachtbaren Fusionswellen eine Sensibilisierung für den Instititutswert stattgefunden. Die in der Vergangenheit meist unzufriedenstellende Rentabilität der Banken mit gleichzeitig zunehmendem Wettbewerb um das Kapital führt dazu, dass sich die Kreditinstitute mit den Forderungen, die durch ihre Anteilseigener gestellt werden, auseinandersetzen müssen.1
[...]
_____
1 Vgl. Behm (1994), S. 1 f.; Hömann (1998), S. 1 f.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Shareholder Value in Banken
- Besondere Bedeutung des Eigenkapitals
- Bankeigenkapitalbegriffe
- Besondere Rolle der Eigenkapitalkosten
- Kapitalmarkttheoretische Modelle zur Eigenkapitalkostenermittlung
- Modellauswahl
- CAPM
- Modellvorstellung
- CAPM bei nicht-börsenotierten Banken
- Kritik
- Optionspreismodell
- Modellvorstellung
- Kritik
- Marktzinsmethode
- Grundmodell
- Modellvorstellung
- Kritik
- Erweitertes Modell
- Modellvorstellung
- Kritik
- Grundmodell
- Vergleich der vorgestellten Modelle
- Zielsetzungen der Modelle
- Vergleich der getroffenen Annahmen
- Praxistauglichkeit
- Kosten/Nutzen-Vergleich
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Kalkulation von Eigenkapitalkosten in Banken und analysiert verschiedene marktorientierte Konzepte zur Ermittlung dieser Kosten. Das Ziel ist es, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle aufzuzeigen und ihre Anwendbarkeit in der Praxis zu bewerten.
- Bedeutung des Eigenkapitals für Banken
- Kapitalmarkttheoretische Modelle zur Eigenkapitalkostenermittlung
- Vergleich der Modelle hinsichtlich ihrer Zielsetzungen, Annahmen und Praxistauglichkeit
- Bewertung der Kosten und Nutzen der einzelnen Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung des Eigenkapitals für Banken und die Besonderheiten der Eigenkapitalkosten beleuchtet. Kapitel 2 präsentiert verschiedene kapitalmarkttheoretische Modelle zur Ermittlung der Eigenkapitalkosten, darunter das CAPM, das Optionspreismodell und die Marktzinsmethode. Die Modelle werden im Detail beschrieben und ihre Kritikpunkte aufgezeigt. In Kapitel 3 werden die vorgestellten Modelle hinsichtlich ihrer Zielsetzungen, Annahmen und Praxistauglichkeit verglichen. Schließlich wird im vierten Kapitel die Kosten und Nutzen der einzelnen Modelle bewertet.
Schlüsselwörter
Eigenkapitalkosten, Banken, Kapitalmarkttheorie, CAPM, Optionspreismodell, Marktzinsmethode, Vergleich, Anwendbarkeit, Praxisrelevanz.
- Quote paper
- Jürgen Hummel (Author), 2000, Marktorientierte Konzepte zur Kalkulation von Eigenkapitalkosten in Banken - Eine vergleichende Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/3486