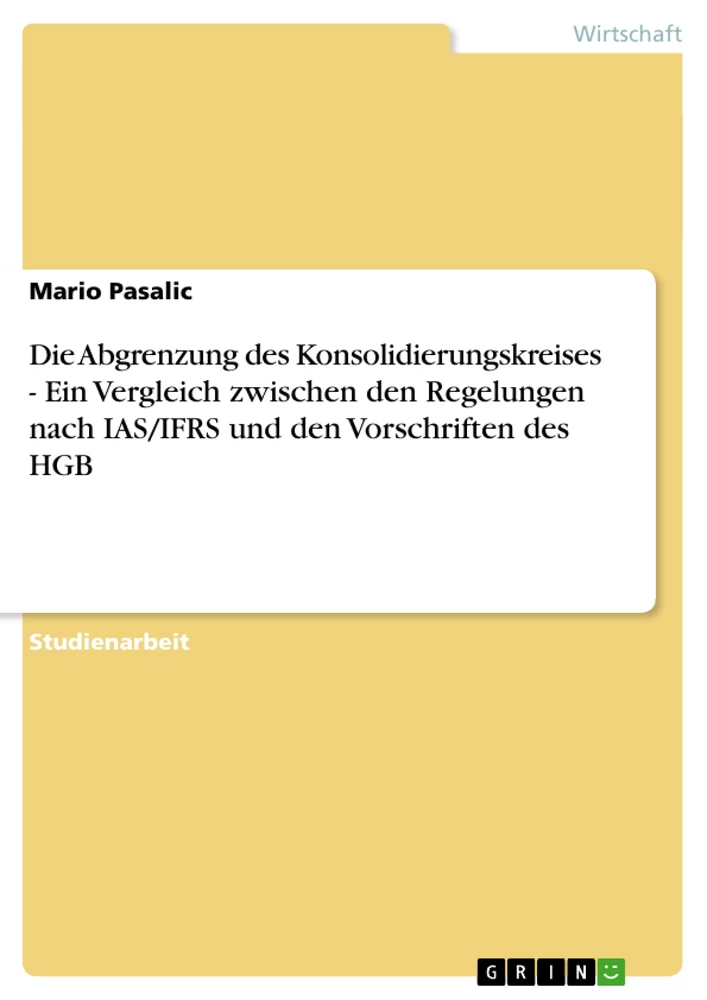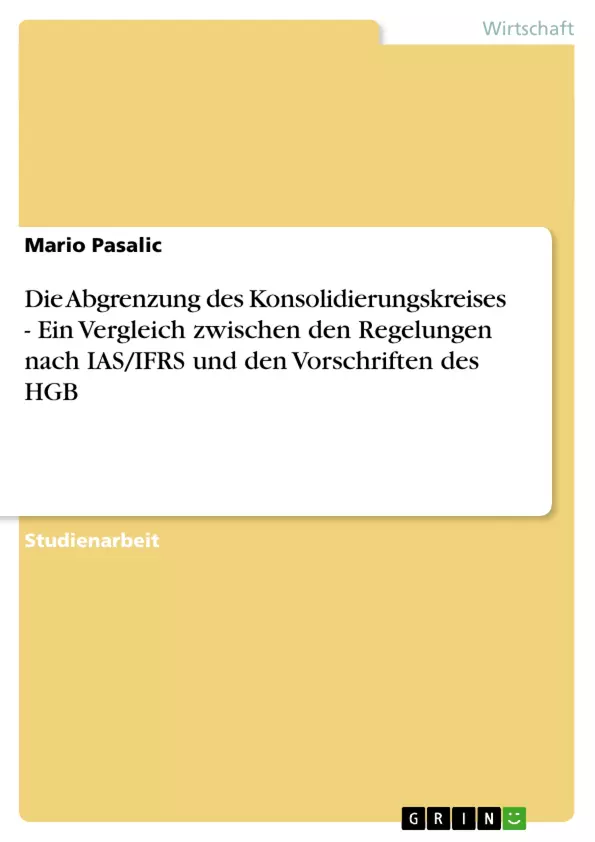Spätestens seit dem Enron-Skandal hat die Festlegung des Konsolidierungskreises an Bedeutung gewonnen. Der texanische Energiekonzern hatte sich Konstruktionen bedient, um Schulden in Milliardenhöhe, die in Zweckgesellschaften ausgelagert waren, nicht in der Konzernbilanz ausweisen zu müssen. Dieser Fall verdeutlicht, dass mit der Definition der wirtschaftlichen Einheit „Konzern“ mindestens ebenso große bilanzpolitische Spielräume verbunden sind, wie dies bei Bilanzansatz-, Bewertungs- und Konsolidierungs-regeln der Fall ist. Daraufhin begann die Diskussion über die Streitrage, welche Kriterien für die Abgrenzung des Konsolidierunsgkreises relevant sein sollten.
Diese Buch untersucht die unterschiedlichen Möglichkeiten der Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IAS/IFRS. Dabei liegt der Fokus hauptsächlich auf den Vollkonsolidierungskreis nach HGB und IAS/IFRS.
Die Untersuchung beginnt mit einem kurzen Überblick über die Stufenkonzeption des HGB. Lediglich in diesem Kapitel wird auf die Qoutenkonsolidierung und die Equity-Methode kurz eingegangen.
Anschließend wird in Kapitel drei explizit auf die Vollkonsolidierung nach HGB eingegangen und es werden die jeweiligen Gebote, Verbote und Wahlrechte besprochen, die auch den thematischen Schwerpunkt dieses Buches ausmachen.
In Kapitel kommt es zur Betrachtung des Vollkonsolidierungskreises nach IAS/IFRS.
In Kapitel fünf werden die jeweiligen Vorschriften zum Konsolidierungskreis beurteilt, um dann mit einer Schlussbetrachtung das Buch abzuschließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Abstufungen der Konzernabgrenzung des HGB
- Die Abgrenzung des Vollkonsolidierungskreises nach HGB
- Konsolidierungsgebot gem. § 294 Abs. 1 HGB
- Mehrstufiger Konzern
- Zweckgesellschaften
- Konsolidierungsverbot gem. § 295 HGB
- Konsolidierungswahlrechte gem. § 296 HGB
- Das Einbeziehungswahlrecht bei der Beschränkung in der Rechtsausübung (gem. § 296 Abs. 1 Nr. 1 HGB)
- Das Einbeziehungswahlrecht bei unverhältnismäßig hohen Kosten oder Verzögerungen (gem. § 296 Abs. 1 Nr. 2 HGB)
- Das Einbeziehungswahlrecht bei beabsichtigter Weiterveräußerung (gem. § 296 Abs. 1 Nr. 3 HGB)
- Das Einbeziehungswahlrecht für unwesentliche Tochterunternehmen (§ 296 Abs. 2 Satz 1 HGB)
- Die Berichtspflichten bei Änderungen des Vollkonsolidierungskreises
- Konsolidierungsgebot gem. § 294 Abs. 1 HGB
- Der Vollkonsolidierungskreis nach IAS/IFRS
- Grundsätzliche Einbeziehungspflicht nach IAS/IFRS gem. IAS 27.11
- Mehrstufiger Konzern
- Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities)
- Das Einbeziehungsverbot nach IAS/IFRS gem. IAS 27.13
- Konsolidierungswahlrechte nach IAS/IFRS
- Grundsätzliche Einbeziehungspflicht nach IAS/IFRS gem. IAS 27.11
- Schlussbetrachtung und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die unterschiedlichen Möglichkeiten der Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IAS/IFRS, mit Fokus auf den Vollkonsolidierungskreis. Ziel ist der Vergleich der Regelungen beider Rechnungslegungsstandards.
- Vergleich der Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IAS/IFRS
- Analyse der Konsolidierungsgebote und -verbote nach HGB
- Untersuchung der Konsolidierungswahlrechte nach HGB und IAS/IFRS
- Bewertung der unterschiedlichen Regelungen im Hinblick auf die Praxis
- Betrachtung der Bedeutung des Konsolidierungskreises im Kontext der Bilanzpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert die Bedeutung der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, insbesondere vor dem Hintergrund des Enron-Skandals, und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf dem Vollkonsolidierungskreis nach HGB und IAS/IFRS. Die Arbeit beginnt mit einem Überblick über die Stufenkonzeption des HGB, bevor sie sich detailliert mit der Vollkonsolidierung nach HGB und IAS/IFRS auseinandersetzt. Der Vergleich der beiden Regelwerke steht im Mittelpunkt der Analyse.
Die Abstufungen der Konzernabgrenzung des HGB: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Stufen der Konzernabgrenzung nach HGB, einschließlich der Quotenkonsolidierung und der Equity-Methode, wobei letztere im weiteren Verlauf nicht weiter betrachtet wird. Es dient als Grundlage für das tiefere Verständnis der Vollkonsolidierung im folgenden Kapitel.
Die Abgrenzung des Vollkonsolidierungskreises nach HGB: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Vorschriften des HGB zur Abgrenzung des Vollkonsolidierungskreises. Es behandelt die Konsolidierungsgebote, -verbote und -wahlrechte, welche den thematischen Schwerpunkt der Arbeit bilden. Die einzelnen Paragraphen des HGB werden im Detail untersucht, um ein umfassendes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Die verschiedenen Wahlrechte bieten Unternehmen Gestaltungsspielräume, die im Kontext der Bilanzpolitik zu beleuchten sind. Der Einfluss verschiedener Faktoren wie Kosten, Verzögerungen und beabsichtigte Weiterveräußerungen auf die Konsolidierungsentscheidungen wird genauestens betrachtet.
Der Vollkonsolidierungskreis nach IAS/IFRS: Dieses Kapitel widmet sich der Betrachtung des Vollkonsolidierungskreises nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IAS/IFRS. Es analysiert die grundsätzliche Einbeziehungspflicht nach IAS 27.11, das Einbeziehungsverbot nach IAS 27.13 und die entsprechenden Wahlrechte. Der Vergleich mit den Regelungen des HGB zeigt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Systeme auf, und legt den Fokus auf die internationale Vergleichbarkeit und Harmonisierung der Rechnungslegung. Besonderes Augenmerk liegt auf den Behandlung von Mehrstufenkonzernen und Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities).
Schlüsselwörter
Konsolidierungskreis, HGB, IAS/IFRS, Vollkonsolidierung, Konzernabgrenzung, Konsolidierungsgebote, Konsolidierungsverbote, Konsolidierungswahlrechte, Bilanzpolitik, Zweckgesellschaften, Mehrstufiger Konzern, internationale Rechnungslegung, Vergleichbarkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IAS/IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die unterschiedlichen Möglichkeiten der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, insbesondere des Vollkonsolidierungskreises, nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS). Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Regelungen beider Rechnungslegungsstandards.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Abstufungen der Konzernabgrenzung nach HGB, die detaillierte Analyse des Vollkonsolidierungskreises nach HGB (inkl. Konsolidierungsgebote, -verbote und -wahlrechte gemäß §§ 294, 295, 296 HGB), den Vollkonsolidierungskreis nach IAS/IFRS (inkl. Einbeziehungspflicht und -verbote gemäß IAS 27), den Vergleich beider Regelwerke und die Bedeutung des Konsolidierungskreises im Kontext der Bilanzpolitik. Besonderes Augenmerk liegt auf Mehrstufenkonzernen und Zweckgesellschaften (inkl. Special Purpose Entities).
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Abstufungen der Konzernabgrenzung nach HGB, ein Kapitel zur Abgrenzung des Vollkonsolidierungskreises nach HGB, ein Kapitel zum Vollkonsolidierungskreis nach IAS/IFRS und eine Schlussbetrachtung mit kritischer Würdigung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der relevanten Vorschriften und Regelungen.
Welche Rechtsvorschriften werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert im Detail die relevanten Paragraphen des HGB (§§ 294, 295, 296) und die einschlägigen Regelungen von IAS 27, um ein umfassendes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel ist ein Vergleich der Regelungen zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IAS/IFRS, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Systeme aufzuzeigen und die Auswirkungen auf die Praxis zu bewerten. Die Arbeit soll auch die Bedeutung des Konsolidierungskreises für die Bilanzpolitik beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Konsolidierungskreis, HGB, IAS/IFRS, Vollkonsolidierung, Konzernabgrenzung, Konsolidierungsgebote, Konsolidierungsverbote, Konsolidierungswahlrechte, Bilanzpolitik, Zweckgesellschaften, Mehrstufiger Konzern, internationale Rechnungslegung, Vergleichbarkeit.
Wie wird der Vollkonsolidierungskreis nach HGB definiert?
Die Definition des Vollkonsolidierungskreises nach HGB ergibt sich aus der Zusammenschau der Konsolidierungsgebote (§ 294 HGB), -verbote (§ 295 HGB) und -wahlrechte (§ 296 HGB). Die Hausarbeit untersucht diese Vorschriften detailliert.
Wie unterscheidet sich der Vollkonsolidierungskreis nach HGB von dem nach IAS/IFRS?
Die Hausarbeit vergleicht die Regelungen zum Vollkonsolidierungskreis nach HGB und IAS/IFRS und hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Konsolidierungswahlrechte und der Behandlung von Mehrstufenkonzernen und Zweckgesellschaften.
Welche Bedeutung hat der Konsolidierungskreis für die Bilanzpolitik?
Die Hausarbeit untersucht die Gestaltungsspielräume, die Unternehmen durch die Konsolidierungswahlrechte erhalten, und deren Auswirkungen auf die Bilanzpolitik.
- Quote paper
- Diplom Betriebswirt Mario Pasalic (Author), 2004, Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises - Ein Vergleich zwischen den Regelungen nach IAS/IFRS und den Vorschriften des HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/34558