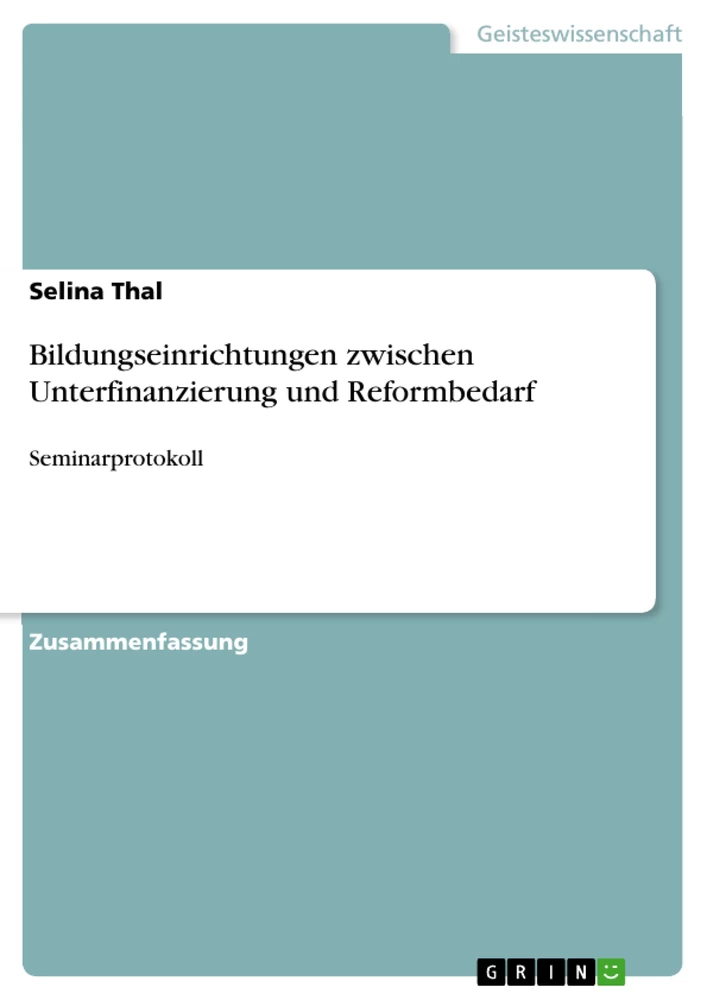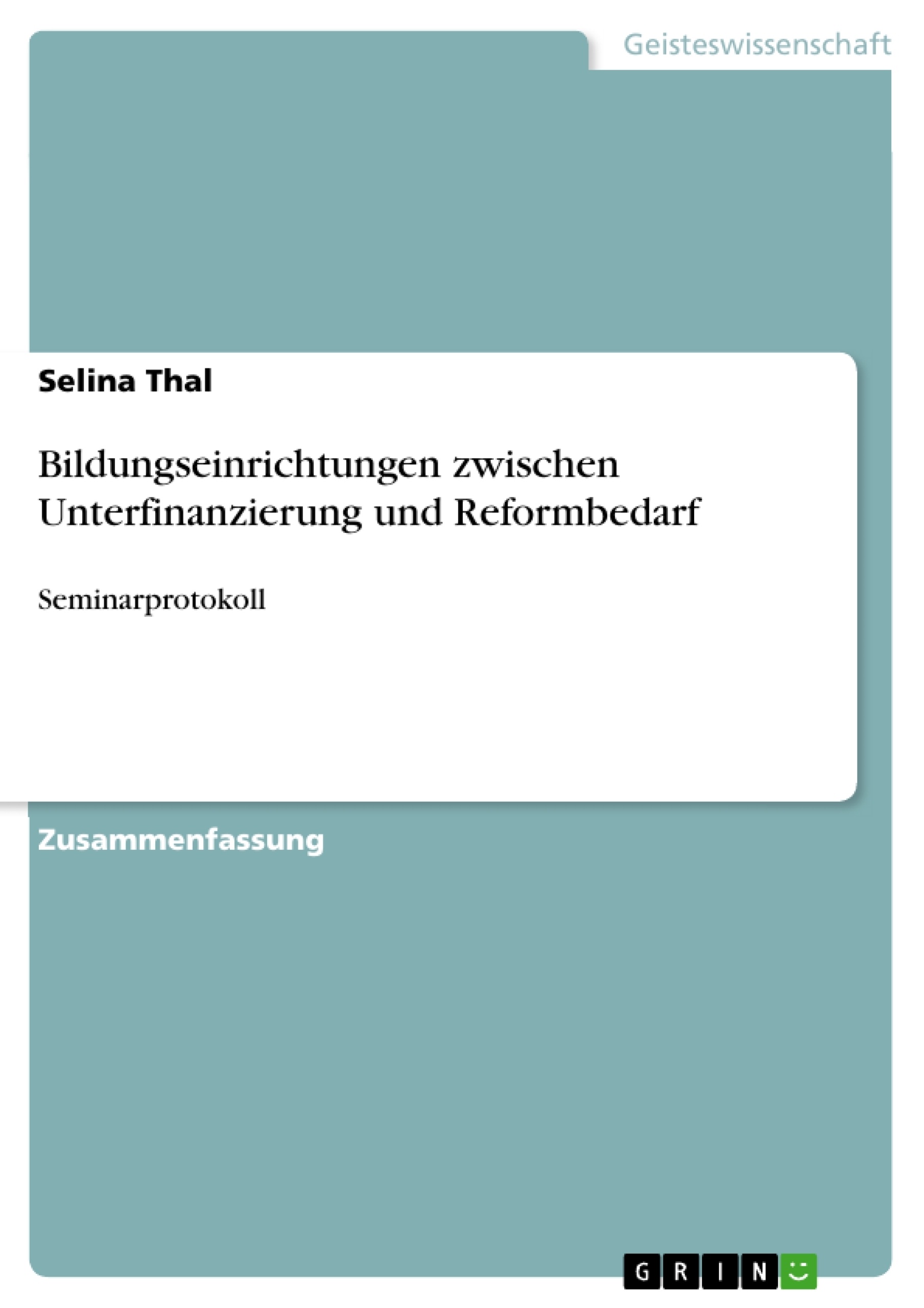Den Hauptgegenstand der Sitzung bildete die Akkreditierung an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland. Als Diskussionsgrundlage diente das eingangs gehaltene Referat „Akkreditierung und Qualitätssicherung“. In diesem Zusammenhang wurden vor allem die Funktionsweise des Systems und die Differenz zwischen System- und Programmakkreditierung thematisiert. Anschließend wurden die im Referat angeführten Kritikpunkte ihrer Relevanz nach eingeschätzt und diskutiert. Die von den Studenten formulierten Fragen zeugten von einem großen Interesse am Akkreditierungsprozess des sozialwissenschaftlichen Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin.
Inhaltsverzeichnis
- Begriffsannäherung
- Geschichte der Akkreditierung
- Das deutsche Akkreditierungssystem
- Arten der Akkreditierung:
- Programmakkreditierung
- Systemakkreditierung
- Kritik
- Arten der Akkreditierung:
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminarprotokoll behandelt das Thema der Akkreditierung an Hochschulen in Deutschland. Es analysiert die Funktionsweise des Akkreditierungssystems, die Unterschiede zwischen Programmakkreditierung und Systemakkreditierung und die Kritikpunkte, die mit dem System verbunden sind.
- Die Funktionsweise des deutschen Akkreditierungssystems
- Die Unterschiede zwischen Programmakkreditierung und Systemakkreditierung
- Die Kritikpunkte an der Akkreditierung
- Die Auswirkungen der Akkreditierung auf die Hochschulautonomie und die Wissenschaftsfreiheit
- Die Frage, ob die Akkreditierung zu einer tatsächlichen Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium führt
Zusammenfassung der Kapitel
Das Seminarprotokoll beginnt mit einer Einführung in den Begriff der Akkreditierung und seiner Anwendung in verschiedenen Bereichen, insbesondere im Hochschulbereich. Es wird erläutert, wie das deutsche Akkreditierungssystem im Zuge des Bologna-Prozesses implementiert wurde und wie es funktioniert. Der Text hebt die Unterschiede zwischen Programmakkreditierung und Systemakkreditierung hervor und diskutiert die Kritikpunkte, die mit dem System verbunden sind.
Der Text analysiert die Kosten und den Aufwand, die mit der Akkreditierung verbunden sind, und diskutiert die Frage, ob die Akkreditierung die Hochschulautonomie und die Wissenschaftsfreiheit einschränkt. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Akkreditierung tatsächlich zu einer Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium führt. Schließlich werden die internationalen Aspekte der Akkreditierung und die Frage, ob die Akkreditierungsagenturen ausreichend Kontakt zum Ausland haben, betrachtet.
Schlüsselwörter
Akkreditierung, Qualitätssicherung, Bologna-Prozess, Programmakkreditierung, Systemakkreditierung, Hochschulautonomie, Wissenschaftsfreiheit, Studiengänge, Qualität von Lehre und Studium, Kritikpunkte, Kosten, Aufwand, Internationalität.
- Quote paper
- Selina Thal (Author), 2008, Bildungseinrichtungen zwischen Unterfinanzierung und Reformbedarf, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/343934