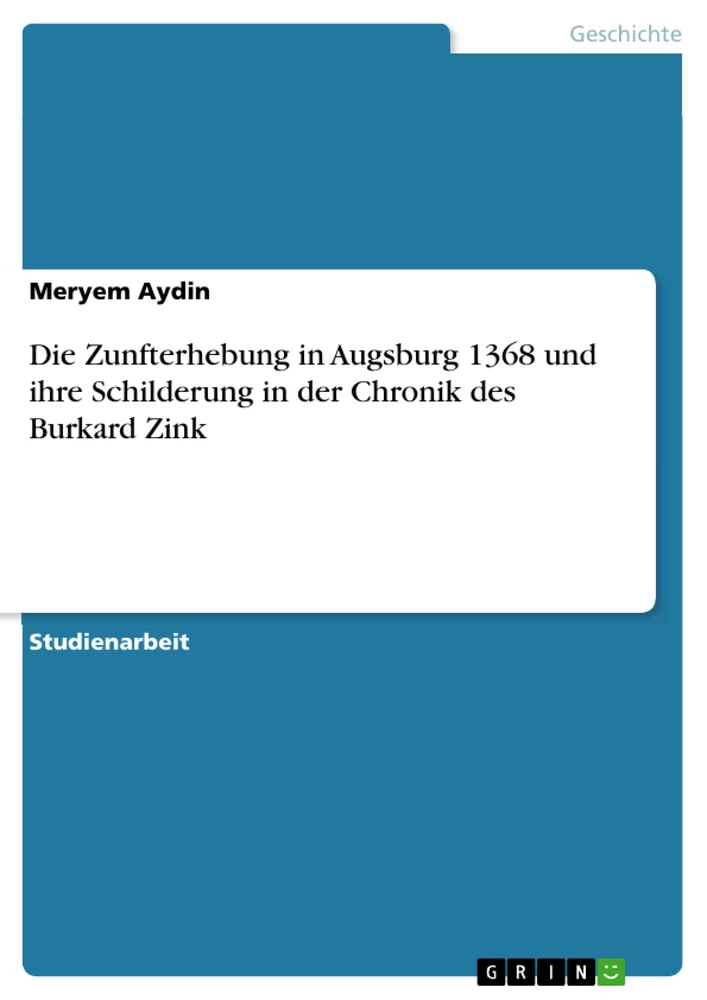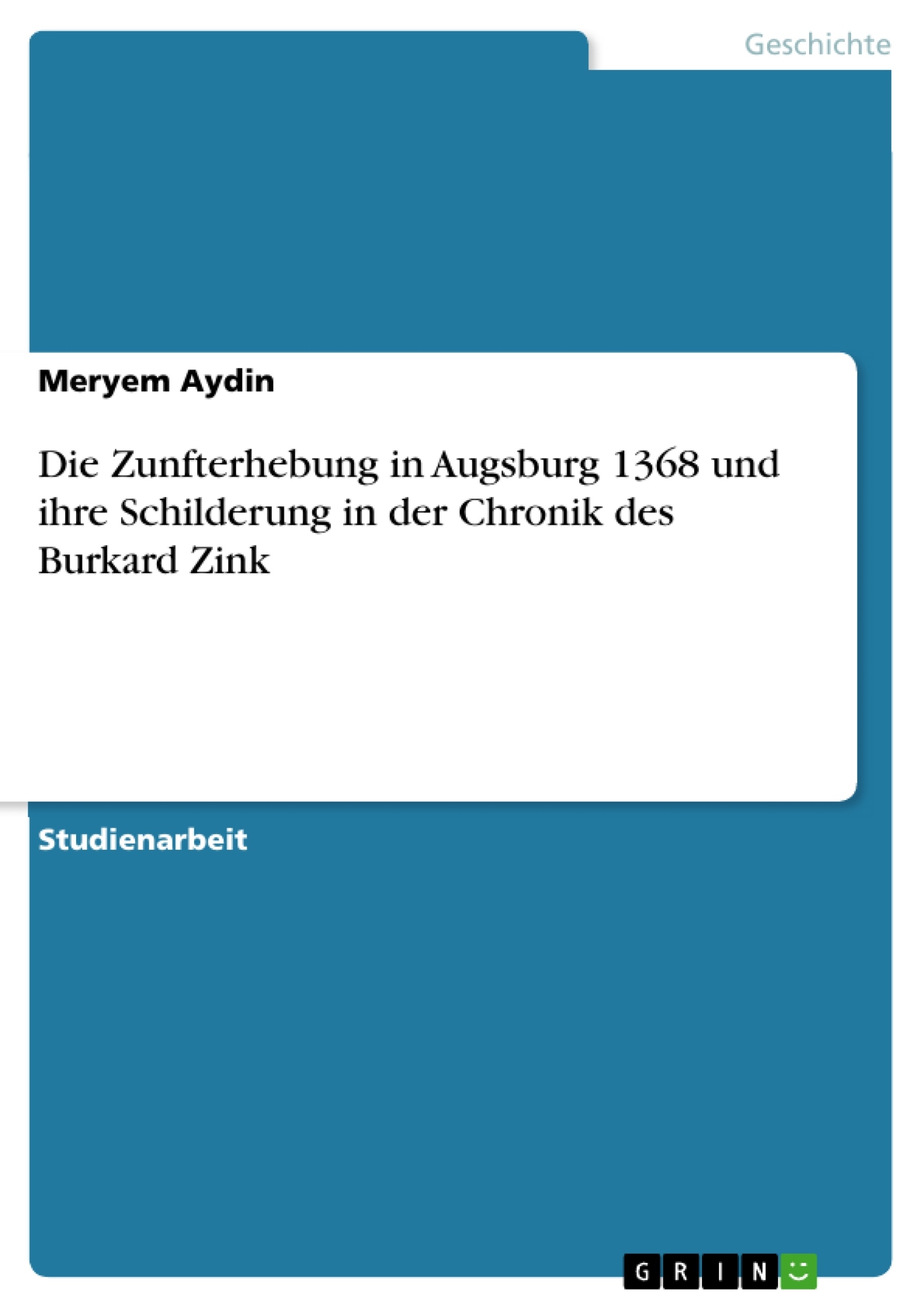Im Jahre 1368 kam es in Augsburg zu einem Aufstand einiger Zünfte. Bis zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu Zunfterhebungen zunächst in Italien gekommen, bevor die Ideen im Jahre 1226-1271 auch in Deutschland Anknüpfung fanden. Die erste deutsche Stadt, in der die Zünfte einen Aufstand wagten, war Basel.
Ziel der Arbeit wird es sein, der Frage nachzugehen, wie die Zünfte in Augsburg einen Aufstand legitimieren und durchsetzen konnten. Als wesentlicher Bestandteil der Analyse ist die Unzufriedenheit des Volkes zu bemerken, die vor allem aufgrund der erhobenen Steuern seitens des Patriziats ausgelöst wurde und in der Forschung als hauptsächlicher Beweggrund der Zunfterhebung in Augsburg gesehen werden kann. Als Primärquelle für den Hauptteil werden die Chroniken des Burkard Zink genutzt. Seine Aussagen über die Zunfterhebung und das „ungelt“ stehen daher im Vordergrund der Ausarbeitung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenkritik
- Was ist eine Zunft?
- Die Zunfterhebung in Augsburg 1368
- Burkard Zink
- Forderungen der Zünfte
- Ablauf der Zunfterhebung
- Ausgang der Zunfterhebung
- Burkard Zink
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Zunfterhebung in Augsburg im Jahre 1368 und analysiert die Rolle des städtischen Chronisten Burkard Zink in diesem historischen Kontext. Die Arbeit untersucht, wie die Zünfte in Augsburg ihren Aufstand legitimierten und durchsetzen konnten, und welche Faktoren dazu führten. Dabei wird die Unzufriedenheit des Volkes, die durch hohe Steuern des Patriziats ausgelöst wurde, als ein wesentlicher Beweggrund für die Zunfterhebung betrachtet. Die Chroniken des Burkard Zink, die im Vordergrund der Ausarbeitung stehen, liefern wichtige Einblicke in die Ereignisse und die politische und gesellschaftliche Situation der Zeit.
- Die Zunfterhebung in Augsburg als Ausdruck der Unzufriedenheit des Volkes mit dem Patriziat
- Die Rolle der Zünfte in der politischen und gesellschaftlichen Ordnung des Mittelalters
- Die Darstellung der Zunfterhebung in den Chroniken des Burkard Zink
- Die Quellenkritik und Interpretation der Chroniken des Burkard Zink
- Die Bedeutung der Zunft als berufsständische Vertretung, Bruderschaft, politische Einheit und militärische Einheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Zunfterhebung in Augsburg 1368 ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie konnten die Zünfte in Augsburg ihren Aufstand legitimieren und durchsetzen? Die Quellenkritik beleuchtet die Chroniken des Burkard Zink als wichtigste Quelle für die Analyse. Das Kapitel „Was ist eine Zunft?“ erläutert die Funktionen und Aufgaben der Zünfte im Mittelalter, um die Bedeutung der Zunfterhebung und die Ziele der Zunftmitglieder besser verstehen zu können. Das Kapitel „Die Zunfterhebung in Augsburg 1368“ analysiert die Ereignisse der Zunfterhebung, die Forderungen der Zünfte, den Ablauf der Erhebung und den Ausgang des Aufstandes. Dabei werden die Aussagen des Burkard Zink über die Zunfterhebung und das „ungelt“ im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Zunfterhebung, Augsburg, Burkard Zink, Chroniken, Patriziat, Unzufriedenheit, Steuern, Zunft, berufsständische Vertretung, politische Einheit, mittelalterliche Gesellschaft, Quellenkritik, ungelt, Stadtgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Hauptgrund für die Zunfterhebung in Augsburg 1368?
Wesentlicher Grund war die Unzufriedenheit des Volkes über die hohen Steuern („ungelt“), die vom herrschenden Patriziat erhoben wurden.
Wer war Burkard Zink und welche Rolle spielt er für die Forschung?
Burkard Zink war ein Chronist, dessen Aufzeichnungen als primäre Quelle für den Ablauf und die Forderungen der Zunfterhebung dienen.
Welche Funktionen hatte eine Zunft im Mittelalter?
Eine Zunft war nicht nur eine berufsständische Vertretung, sondern auch eine Bruderschaft, politische Einheit und militärische Organisation.
Wie verlief der Aufstand der Zünfte in Augsburg?
Die Arbeit analysiert den Ablauf von der Artikulation der Forderungen bis hin zur Durchsetzung politischer Mitsprache gegen das Patriziat.
War Augsburg die erste Stadt mit einer Zunfterhebung?
Nein, Zunfterhebungen begannen in Italien und fanden in Deutschland zuerst in Basel (1226-1271) statt, bevor sie Augsburg erreichten.
- Arbeit zitieren
- Meryem Aydin (Autor:in), 2016, Die Zunfterhebung in Augsburg 1368 und ihre Schilderung in der Chronik des Burkard Zink, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/343160