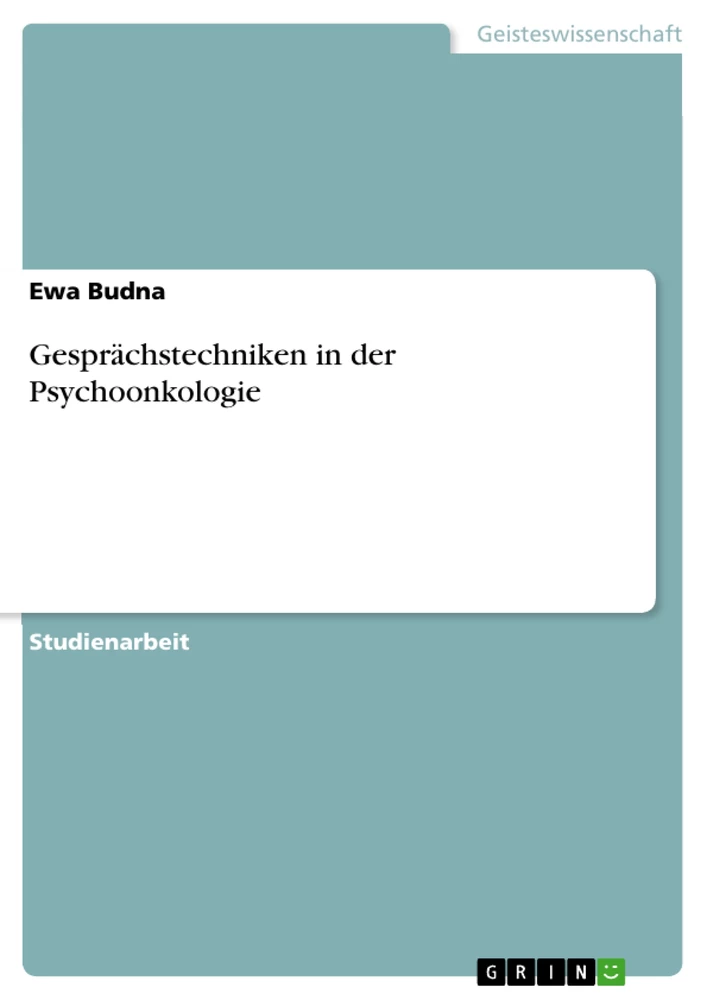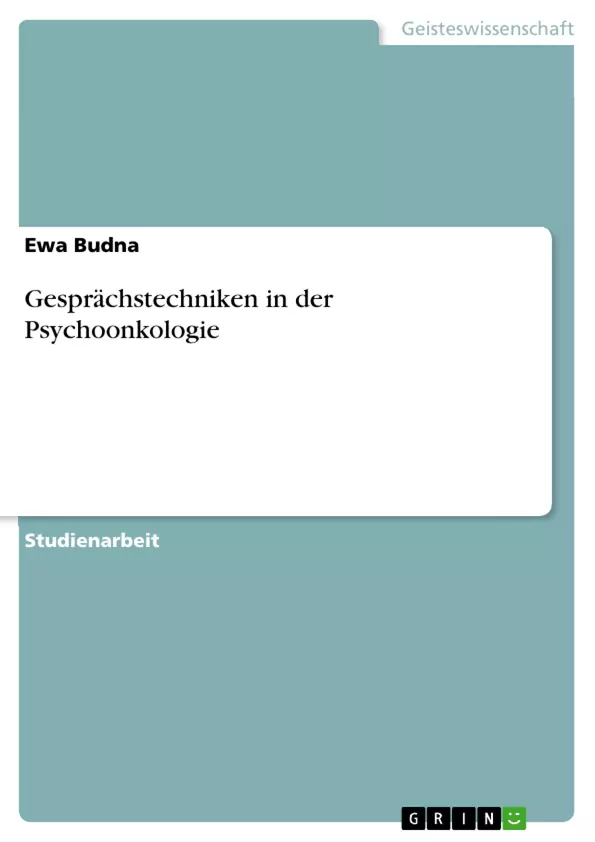Der vorliegene Text behandelt die Fragen welche Besonderheiten es im psychoonkologischen Erstgespräch gibt und wie ressourcenorientierte und klientenzentrierte Gesprächstechniken sowie das Prinzip der bipolaren Psychotherapie – unter Berücksichtigung der Merkmale – im psychoonkologischen Erstgespräch eingesetzt werden können.
Die Psychoonkologie – oder auch psychosoziale Onkologie – ist eine klinische wissenschaftliche Disziplin, die die Wechselwirkungen zwischen körperlichen, seelischen und sozialen Einflüssen in der Entstehung und im gesamten Verlauf einer Krebserkrankung untersucht. Ziel ist es, das so gewonnene Wissen systematisch in der Prävention, Früherkennung, Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation von PatientInnen zu nutzen.
Einfühlsame, empathische und kompetente Ärzte haben schon in den frühen 1950er Jahren erkannt, wie sehr bei einer onkologischen Erkrankung Körper, Seele und Geist betroffen sind, und auch die Belastungen der Angehörigen identifiziert. In der Psychoonkologie geht es heutzutage nicht mehr nur um die Verbesserung der psychosozialen Versorgung von KrebspatientInnen und ihren Angehörigen, sondern sie beschäftigt sich auch mit Aus- und Weiterbildung sowie Wissenschaft und Forschung.
Inhaltsverzeichnis
- PSYCHOSOZIALE VERSORGUNG KREBSKRANKER..
- Psychoneuroimmunologie (PNI): Ergebnisse wissenschaftlicher Studien.
- Exkurs - Krisenintervention
- DAS ERSTGESPRÄCH IN DER PSYCHOONKOLOGIE.......
- Klientenzentrierte Gesprächsführung und ihre Bedeutung im Erstgespräch.
- Empathie bzw. einfühlendes Verstehen.......
- Wertschätzung und positive Zuwendung.
- Kongruenz.
- Ressourcen aktivieren durch Sprache im Erstgespräch
- Fragen......
- Das Benutzen von Was- und Welche-Fragen
- Ein Wort.
- Sprache und Körper
- Klientenzentrierte Gesprächsführung und ihre Bedeutung im Erstgespräch.
- DAS BIPOLARE PRINZIP DER PSYCHOTHERAPIE
- Die Sprache der prozessorientierteren Therapie.
- Die Ich- und die Sie-Intervention in der Sprache
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Gesprächstechniken im psychoonkologischen Erstgespräch. Ziel ist es, die Besonderheiten des psychoonkologischen Erstgesprächs zu beleuchten und ressourcenorientierte und klientenzentrierte Gesprächstechniken sowie das Prinzip der bipolaren Psychotherapie im Kontext des Erstgesprächs zu analysieren.
- Psychosoziale Versorgung Krebskranker und die Bedeutung der Psychoonkologie.
- Psychoneuroimmunologie und der Einfluss von Stress auf das Immunsystem.
- Klientenzentrierte Gesprächsführung im psychoonkologischen Erstgespräch.
- Ressourcenaktivierung durch Sprache und das bipolare Prinzip der Psychotherapie.
- Die Rolle von Angehörigen in der Psychoonkologie.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die psychosoziale Versorgung Krebskranker und erläutert die Bedeutung der Psychoonkologie als interdisziplinäre Disziplin, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen körperlichen, seelischen und sozialen Einflüssen bei Krebserkrankungen beschäftigt. Das Kapitel beleuchtet auch die Entwicklung der Psychoonkologie und die Herausforderungen, die sich aus der Bewältigung von Krebserkrankungen ergeben.
Kapitel 1.1 beschäftigt sich mit der Psychoneuroimmunologie (PNI) und den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Einfluss von psychischen Belastungen auf das Immunsystem. Die Diskussion umfasst den Zusammenhang zwischen Stress, Immunsystem und Krebserkrankungen, wobei die Bedeutung von Ressourcenaktivierung und Stressregulation hervorgehoben wird.
Kapitel 2 konzentriert sich auf das Erstgespräch in der Psychoonkologie. Es werden die Prinzipien der klientenzentrierten Gesprächsführung, wie Empathie, Wertschätzung und Kongruenz, erläutert. Darüber hinaus wird die Aktivierung von Ressourcen durch Sprache im Erstgespräch beleuchtet, wobei verschiedene Techniken wie Fragen, das Benutzen von Was- und Welche-Fragen sowie die Bedeutung von Sprache und Körper dargestellt werden.
Kapitel 3 beleuchtet das bipolare Prinzip der Psychotherapie. Es wird die Sprache der prozessorientierteren Therapie und die Rolle von Ich- und Sie-Interventionen in der Sprache erläutert.
Schlüsselwörter
Psychoonkologie, Erstgespräch, Gesprächstechniken, Klientenzentrierung, Ressourcenaktivierung, bipolare Psychotherapie, Psychoneuroimmunologie, Stress, Immunsystem, Angehörige, Lebensqualität.
- Quote paper
- Ewa Budna (Author), 2016, Gesprächstechniken in der Psychoonkologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/342322