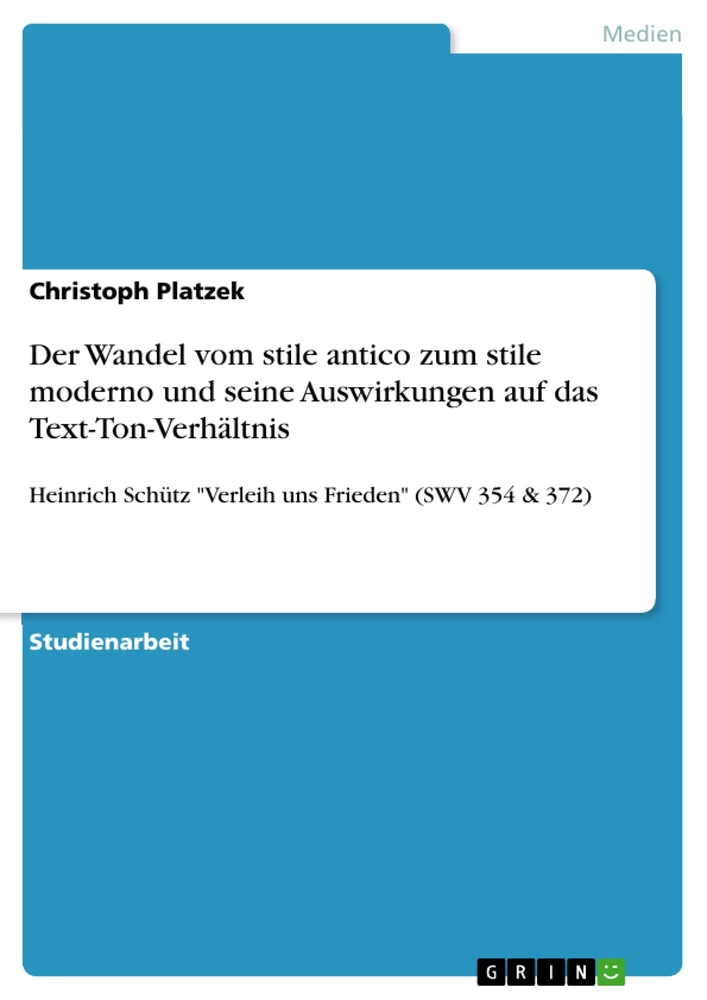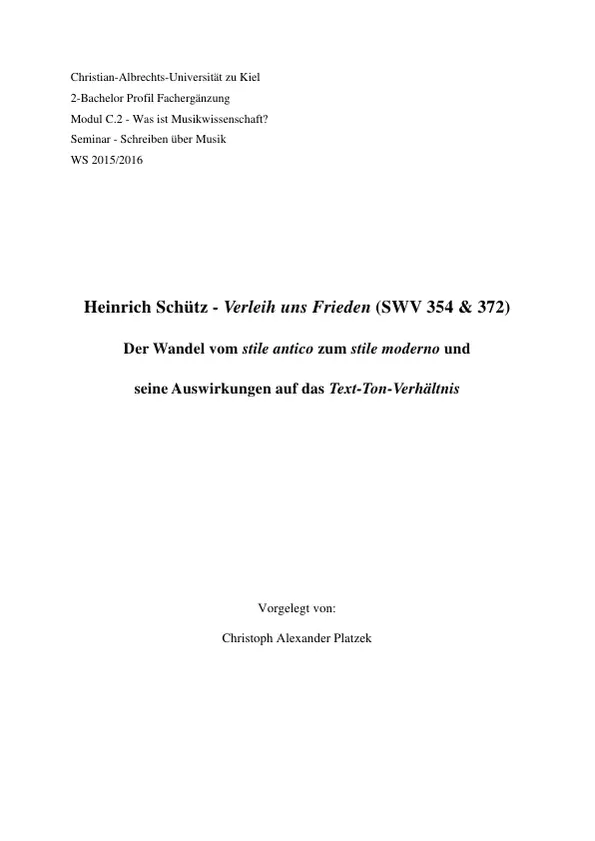Heinrich Schütz hat zwei Vertonungen des Kirchenliedes Verleih uns Frieden konzipiert: Zum einen diese, welche in die Symphoniae sacrae II (1647) eingebunden wurde, zum anderen jene, welche in Form der vierten Motette in der Geistlichen Chormusik (1648) wiederzufinden ist. Diese Tatsache bietet eine gute Arbeitsgrundlage, um die verschiedenen Kompositionstechniken der zwei Fassungen zu analysieren und sie schlussendlich miteinander zu vergleichen.
Somit setzt sich diese Arbeit das übergeordnete Ziel, den großen Stilwandel um 1600 zu untersuchen, um anhand der dadurch gewonnen Ergebnisse Rückschlüsse auf die Entwicklung des Text-Ton-Verhältnisses in Schütz’ Werken ziehen zu können.
Der Arbeit liegen hierbei vorrangig zwei Werke zu Grunde: zum einen die Komponisten-biographie von Martin Gregor-Dellin und zum anderen die im Jahre 2015 erschienene Werkeinführung zur Geistlichen Chormusik des Hamburger Musikwissenschaftlers Sven Hiemke.
Über das gesteckte Ziel dieser Arbeit hinausgehend, lässt sich in der Forschung ein Trend ausmachen, welcher versucht, die Veröffentlichung der Geistlichen Chormusik und das Ende des Dreißigjährigen Krieges in Verbindung zu setzen. Somit gelte die Motette Verleih uns Frieden in diesem Kontext als Schütz’ musikalischer Kommentar auf den sich herauskristallisierenden Westfälischen Frieden im Jahre 1648 .
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabe 1: Ein Programmhefttext
- Aufgabe 2: Heinrich Schütz - Verleih uns Frieden SWV 354 & 372
- 1. Einführung
- 2. Analysen
- 2.1 Die Kirchenweise Verleih uns Frieden
- 2.2 Musikalische Analyse von SWV 372
- 2.3 Musikalische Analyse von SWV 354
- 3. Musikhistorische Einordnung
- 3.1 Stilgeschichte
- 3.2 Das Text-Ton-Verhältnis
- 4. Gattungsgeschichtliche Terminologie
- 4.1 Die Motette
- 4.2 Das Geistliche Konzert
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit den beiden Vertonungen des Kirchenliedes „Verleih uns Frieden“ von Heinrich Schütz, SWV 354 und 372. Die Arbeit analysiert die musikalischen Unterschiede zwischen den beiden Kompositionen und setzt sie in einen musikhistorischen Kontext. Dabei wird der Wandel vom stile antico zum stile moderno und seine Auswirkungen auf das Text-Ton-Verhältnis beleuchtet.
- Der Wandel vom stile antico zum stile moderno und seine Auswirkungen auf die Kompositionsweise.
- Die Analyse der beiden Vertonungen von „Verleih uns Frieden“ im Hinblick auf musikalische Gestaltung und Text-Ton-Verhältnis.
- Die Einordnung der Werke in die Gattungen Motette und Geistliches Konzert.
- Die Bedeutung von Heinrich Schütz für die Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts.
- Die Rezeption und Interpretation der Werke im Laufe der Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik und stellt die beiden Vertonungen von „Verleih uns Frieden“ vor. Die anschließenden Analysen untersuchen die musikalischen Eigenheiten der beiden Werke, wobei die Kirchenweise Verleih uns Frieden, die musikalische Analyse von SWV 372 und SWV 354 behandelt werden. Das Kapitel „Musikhistorische Einordnung“ beleuchtet den Stilwandel vom stile antico zum stile moderno und seine Bedeutung für die Kompositionen von Schütz. Die Gattungsgeschichtliche Terminologie behandelt die Gattungen Motette und Geistliches Konzert, zu denen die Werke gehören. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Heinrich Schütz, Verleih uns Frieden, Motette, Geistliches Konzert, stile antico, stile moderno, Text-Ton-Verhältnis, Kontrapunkt, Polyphonie, Monodie, Kirchenlied, Musikgeschichte, 17. Jahrhundert.
- Quote paper
- Christoph Platzek (Author), 2016, Der Wandel vom stile antico zum stile moderno und seine Auswirkungen auf das Text-Ton-Verhältnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/340700