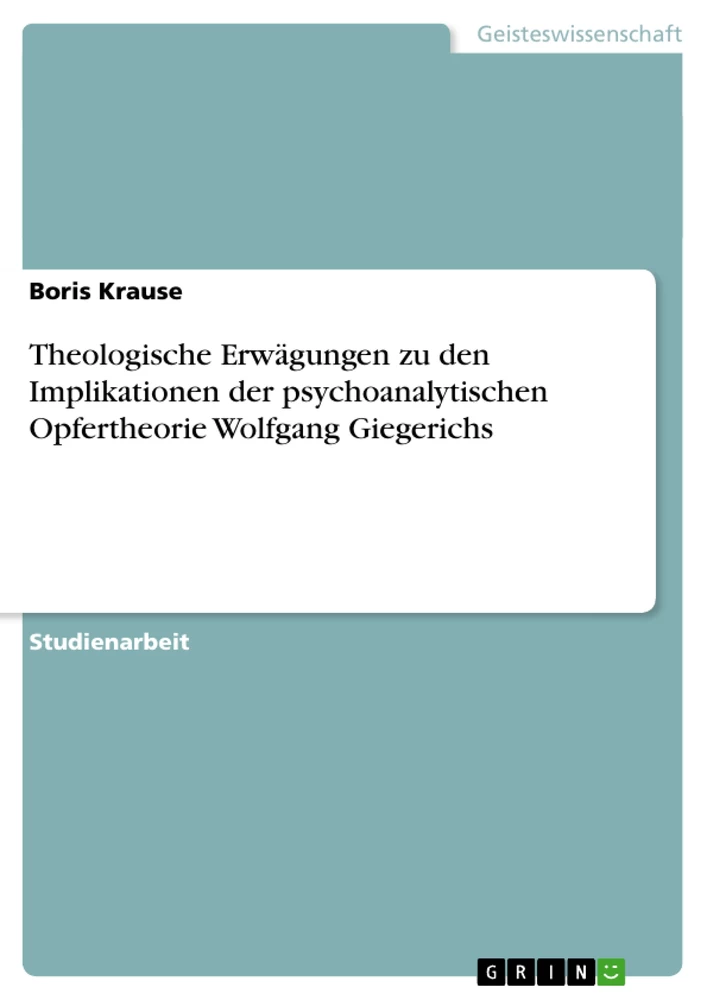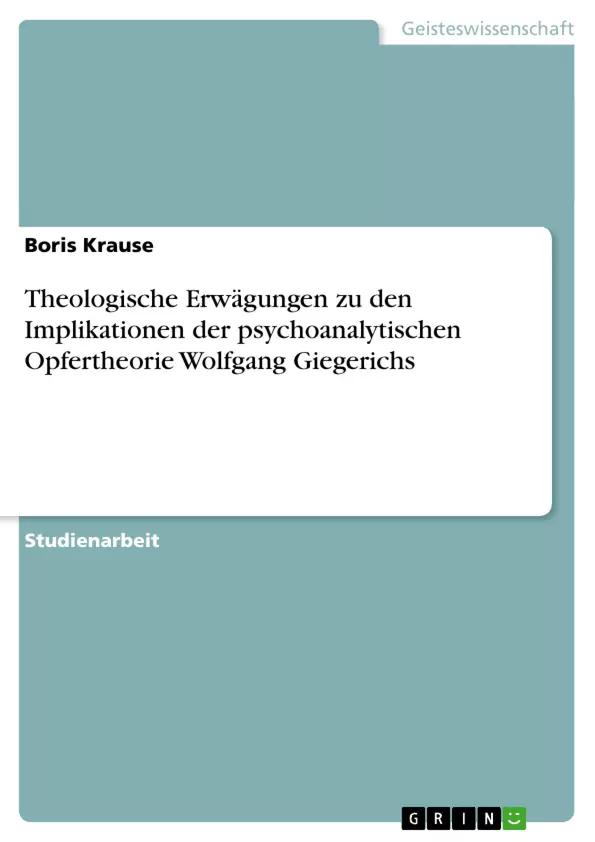Seit geraumer Zeit leiten Humanwissenschaftler in ihren Opfertheorien anhand empirischer Untersuchungen einen Zusammenhang von bereits zu menschlichen Urzeiten vollzogenen Gewalttaten in Form von Opfern und der Entstehung einer menschlichen Denknotwendigkeit des Sakralen ab. Wolfgang Giegerich folgt den opfertheoretischen Entwürfen eines Girards oder Burkerts und modifiziert diese im Hinblick auf einen psychoanalytischen Versuch der Verhältnisbestimmung von Opfertat und dem Heiligen. Angesichts der in diesen Opfertheorien für so wichtig erklärten Bedeutung der Gewalt für den ‚sakralen Entstehungsprozess’, fühlt sich eine Reihe von Theologen dazu herausgefordert, aus ihrer – zuweilen auch interdisziplinären - Perspektive ihr Opferverständnis darzulegen und so die humanwissenschaftlichen Theorien auf ihre Resultate hin zu befragen. Dass die Theologie hier ernstzunehmende Einwände äußern kann, ist hinreichende Motivation dafür, sie in dieser Arbeit – wenn auch nicht in ihrer ganzen Fülle und im Detail – zu erwähnen und zu umschreiben. Da die Opferthematik für mehrere theologische Disziplinen Relevanz zeigt, werden für den Vergleich mit dem Opferbegriff Giegerichs exegetische, dogmatisch-soteriologische, fundamentaltheologische sowie pastoraltheologische Gesichtspunkte zu nennen sein. Die Hauptakzente liegen dabei neben der Darstellung des Ansatzes Giegerichs auf der Klärung des jüdisch-christlichen Opferbegriffs und schließlich in der Gegenüberstellung beider Sichtweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Opferthematik aus Sicht der modernen Psychoanalyse: W. Giegerich
- Das Problem der Nicht-Anerkennung von Gewalt als einem Ingredienz der wirklichen Welt
- Seele und Opfertötungen – eine Verhältnisbestimmung aus zeitgenössischer psychoanalytischer Sicht
- Die Anima-Stufe: Selbsterschaffung der Seele
- Animus-Stufe: vertikale Differenzierung der Seele
- Zwischenbetrachtung
- Das Opfer nach jüdisch-christlichem Verständnis
- Das Opfer im Alten Testament: Opferkult und Geschichte
- Opfer Jesu?
- Das Opfer als ontischer Stabilisierungsfaktor der Psyche?
- Hinweise auf ein verkürztes Opferverständnis
- Gründungsmord - die Geburt Gottes?
- Weitere kritische Anmerkungen
- Das Ende der Gewalt? Schlussbemerkungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der psychoanalytischen Opfertheorie Wolfgang Giegerichs und setzt sie in Beziehung zum jüdisch-christlichen Opferverständnis. Ziel ist es, die humanwissenschaftlichen Theorien auf ihre theologischen Implikationen hin zu befragen und einen Vergleich beider Perspektiven vorzunehmen. Die Arbeit untersucht, wie die Bedeutung von Gewalt in der Entstehung des Sakralen sowohl aus psychoanalytischer als auch theologischer Sicht verstanden wird.
- Die psychoanalytische Opfertheorie Giegerichs und seine Auseinandersetzung mit Gewalt.
- Das Verhältnis von Gewalt, Seele und Opferhandlungen nach Giegerich.
- Der jüdisch-christliche Opferbegriff im Alten und Neuen Testament.
- Vergleich und Gegenüberstellung der psychoanalytischen und theologischen Opferverständnisse.
- Die Rolle des Opfers als ontischer Stabilisierungsfaktor der Psyche.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Forschungsstand zu Opfertheorien in den Humanwissenschaften. Sie stellt die Relevanz einer theologischen Auseinandersetzung mit diesen Theorien heraus und benennt die Perspektive der Arbeit, die den Ansatz Giegerichs mit dem jüdisch-christlichen Opferverständnis vergleicht. Die Hauptakzente liegen auf der Darstellung von Giegerichs Ansatz, der Klärung des jüdisch-christlichen Opferbegriffs und der Gegenüberstellung beider Sichtweisen.
Die Opferthematik aus Sicht der modernen Psychoanalyse: W. Giegerich: Dieses Kapitel stellt den psychoanalytischen Ansatz Giegerichs vor, der Gewalt als zentrales Element der menschlichen und psychischen Entwicklung betrachtet. Es diskutiert das Problem der Nicht-Anerkennung von Gewalt und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Psyche. Giegerich kritisiert den psychoanalytischen Schattenbegriff als unzureichend, da er eine binäre Moralstruktur von Gut und Böse aufrechterhält. Er plädiert stattdessen für eine umfassende Integration von Gewalt in die Seele, um den Schattenbegriff letztlich zu überwinden.
Das Opfer nach jüdisch-christlichem Verständnis: Dieses Kapitel untersucht den Opferbegriff aus jüdisch-christlicher Perspektive. Es beleuchtet den Opferkult im Alten Testament und dessen historische Entwicklung. Weiterhin wird die Bedeutung des Opfers Jesu im Neuen Testament thematisiert. Der Abschnitt analysiert kritisch, ob das Opfer als ontischer Stabilisierungsfaktor der Psyche verstanden werden kann, wobei unterschiedliche Interpretationen und ein verkürztes Opferverständnis diskutiert werden. Die Geburt Gottes im Kontext des Gründungsmordes wird ebenfalls thematisiert. Schließlich werden weitere kritische Anmerkungen zum Thema hinzugefügt.
Schlüsselwörter
Opfertheorie, Psychoanalyse, Wolfgang Giegerich, Gewalt, Sakrales, jüdisch-christliches Opferverständnis, Schattenbegriff, Seele, Gewaltintegration, Altes Testament, Neues Testament, Theologie, Humanwissenschaften.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Psychoanalytische und theologische Opferverständnisse
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die psychoanalytische Opfertheorie von Wolfgang Giegerich mit dem jüdisch-christlichen Opferverständnis. Sie untersucht, wie Gewalt in der Entstehung des Sakralen aus beiden Perspektiven verstanden wird und befragt humanwissenschaftliche Theorien auf ihre theologischen Implikationen hin.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die psychoanalytische Opfertheorie von Wolfgang Giegerich mit dem jüdisch-christlichen Opferbegriff, der sowohl das Alte als auch das Neue Testament umfasst.
Welche Aspekte der psychoanalytischen Theorie Giegerichs werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Giegerichs Sicht auf Gewalt als zentrales Element der psychischen Entwicklung, seine Kritik am psychoanalytischen Schattenbegriff und seinen Ansatz einer umfassenden Integration von Gewalt in die Seele. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Anima und des Animus in diesem Kontext gewidmet.
Wie wird der jüdisch-christliche Opferbegriff dargestellt?
Der jüdisch-christliche Opferbegriff wird anhand des Opferkults im Alten Testament und der Bedeutung des Opfers Jesu im Neuen Testament beleuchtet. Die Arbeit diskutiert kritisch die Interpretation des Opfers als ontischen Stabilisierungsfaktor der Psyche und thematisiert die "Geburt Gottes" im Kontext des Gründungsmordes.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Opfertheorie, Psychoanalyse, Gewalt, Sakrales, Schattenbegriff, Seele, Gewaltintegration, Altes Testament, Neues Testament, Theologie und Humanwissenschaften.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Opferthematik aus Sicht der modernen Psychoanalyse (Giegerich), ein Kapitel über das Opfer nach jüdisch-christlichem Verständnis und abschließende Schlussbemerkungen und einen Ausblick.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, einen Vergleich zwischen der psychoanalytischen und der theologischen Perspektive auf das Opfer und die Rolle der Gewalt zu ermöglichen und die theologischen Implikationen der humanwissenschaftlichen Theorien zu untersuchen.
Welche kritischen Aspekte werden diskutiert?
Kritische Aspekte umfassen die Auseinandersetzung mit einem möglicherweise verkürzten Opferverständnis im jüdisch-christlichen Kontext, die kritische Betrachtung des Schattenbegriffs in der Psychoanalyse und die Frage nach der Rolle der Gewalt in der Entstehung des Sakralen.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die zentralen Inhalte und Argumente zusammenfasst.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für die Schnittstelle zwischen Psychoanalyse, Theologie und den Humanwissenschaften interessieren, insbesondere im Kontext von Opfertheorien und der Rolle der Gewalt.
- Arbeit zitieren
- Boris Krause (Autor:in), 2002, Theologische Erwägungen zu den Implikationen der psychoanalytischen Opfertheorie Wolfgang Giegerichs, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/34063