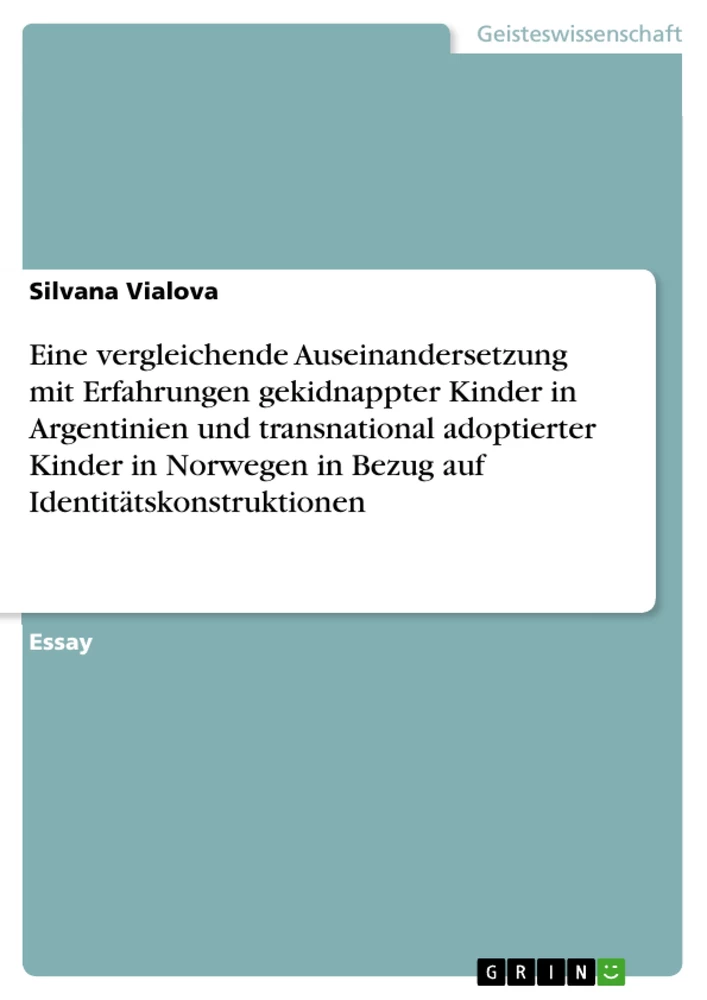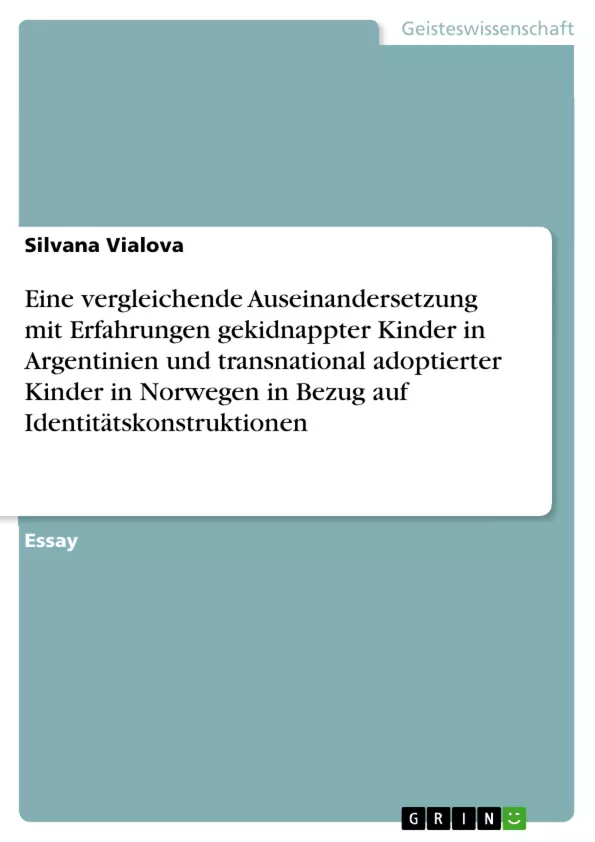500 Kinder wurden während der Militärdiktatur in Argentinien zwischen 1976 und 1983 als Neugeborene oder im Säuglingsalter gekidnappt und sind unbehelligt dieser Umstände in einer Familie groß geworden, die direkt oder indirekt in ein Verbrechen an ihren biologischen ErzeugerInnen involviert waren. Sie sind Teil einer Familie, die nicht das gleiche Blut mit ihnen teilt und belegen Personen mit Verwandtschaftsterminologien ohne genetische Gemeinsamkeiten mit ihnen zu haben. Teil einer Familie zu sein, ohne gleiche genetische Grundlagen zu besitzen, ist unter legalen Umständen ein als Adoption bezeichnetes Phänomen. Doch inwiefern entspricht oder ähnelt die Erfahrung, die diese Kinder der Verschwundenen machen, der, einer Adoption?
Adoptionserfahrungen als solche können selbstverständlich sehr unterschiedlicher Natur sein, differieren im Hinblick auf ihren Kontext, ihre Umstände und ihre historische Einbettung. Deshalb möchte ich mich in dieser Abhandlung auf den Vergleich mit Erfahrungen beschränken, die im Zusammenhang mit transnationaler Adoption in Norwegen beschrieben wurden und lege dabei den Fokus auf die Konstruktion von Identität.
Inhaltsverzeichnis
- Kidnapping Opfer oder Adoptivkinder?
- Identitätskonstruktionen
- Zwei unterschiedliche Ausgangssituationen
- Der Fokus auf soziale Verwandtschaft
- Ein „hidden aspect“ der Identität
- Die „Debiologisierung“ des Kindes
- Die Bedeutung des biologischen Ursprungs
- Identitätskonflikte und Inkorporierungsverfahren
- Transsubstantiation und Identitätsentwicklung
- Die Transsubstantiation des Kindes
- Van Genneps Theorie der Übergangsriten
- Die Integrationsphase und „rekinning“
- Der Wandel der Identität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Erfahrungen gekidnappter Kinder in Argentinien mit denen transnational adoptierter Kinder in Norwegen zu vergleichen, um die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Identitätskonstruktion zu beleuchten. Im Fokus stehen dabei die Prozesse der Inkorporation in die neue Familie und die Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln. Die Arbeit untersucht, wie Kinder, die in beiden Situationen aufwachsen, mit der Frage der biologischen und sozialen Verwandtschaft umgehen.
- Identitätsfindung und -konstruktion im Kontext von Adoption und Kindesentführung
- Die Rolle der Familie und der sozialen Umwelt bei der Prägung der Identität
- Der Einfluss der biologischen Herkunft auf die Selbstwahrnehmung
- Die Bedeutung des Wissens um den eigenen Ursprung und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
- Der Prozess der Transsubstantiation und die Phasen des Identitätswandels
Zusammenfassung der Kapitel
- Kidnapping Opfer oder Adoptivkinder?: Die Arbeit stellt den Vergleich zwischen gekidnappten Kindern in Argentinien und transnational adoptierten Kindern in Norwegen an und beleuchtet die unterschiedlichen Ausgangssituationen und die Bedeutung der sozialen Verwandtschaft. Sie untersucht die Strategien der Familien, die Herkunft der Kinder zu verschweigen oder zu relativieren und welche Auswirkungen dies auf die Identitätsentwicklung der Kinder hat.
- Identitätskonstruktionen: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Aspekten der Identitätsentwicklung in beiden Kontexten. Es analysiert die Bedeutung des biologischen Ursprungs und zeigt, wie die Kinder mit der „Debiologisierung“ und der Konstruktion eines neuen Lebens umgehen. Es wird auch auf die Rolle der Adoptiveltern und der Gesellschaft bei der Integration der Kinder in die neue Welt hingewiesen.
- Transsubstantiation und Identitätsentwicklung: In diesem Kapitel wird der Prozess der Transsubstantiation analysiert, der sowohl bei Adoptierten als auch bei den gekidnappten Kindern stattfindet. Es wird die Bedeutung der Trennung von der alten Identität und der Integration in eine neue soziale und biologische Familie beleuchtet. Die Arbeit greift dabei auf die Theorie der Übergangsriten nach Van Gennep zurück und betrachtet die drei Phasen der Separation, Liminalität und Integration.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Identitätskonstruktion, Adoption, Kindesentführung, biologische und soziale Verwandtschaft, Transsubstantiation, Übergangsriten, argentinische Militärdiktatur, Norwegen, „debiologisierung“, „rekinning“ und die Menschenrechtsorganisation „Abuelas de la Plaza Mayo“.
- Quote paper
- Silvana Vialova (Author), 2016, Eine vergleichende Auseinandersetzung mit Erfahrungen gekidnappter Kinder in Argentinien und transnational adoptierter Kinder in Norwegen in Bezug auf Identitätskonstruktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/340214