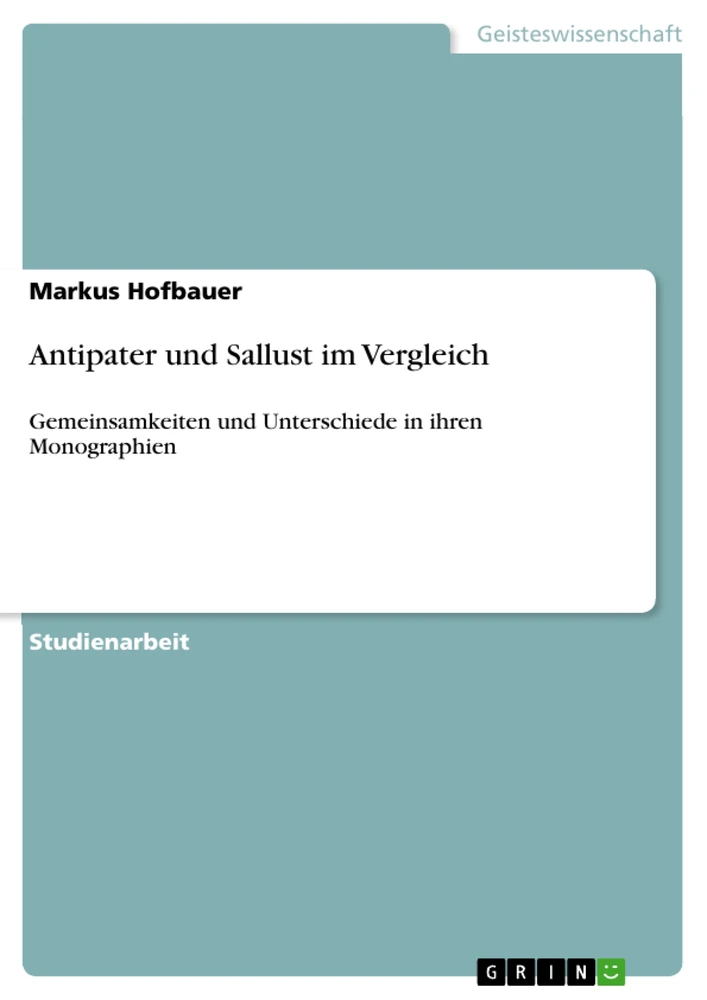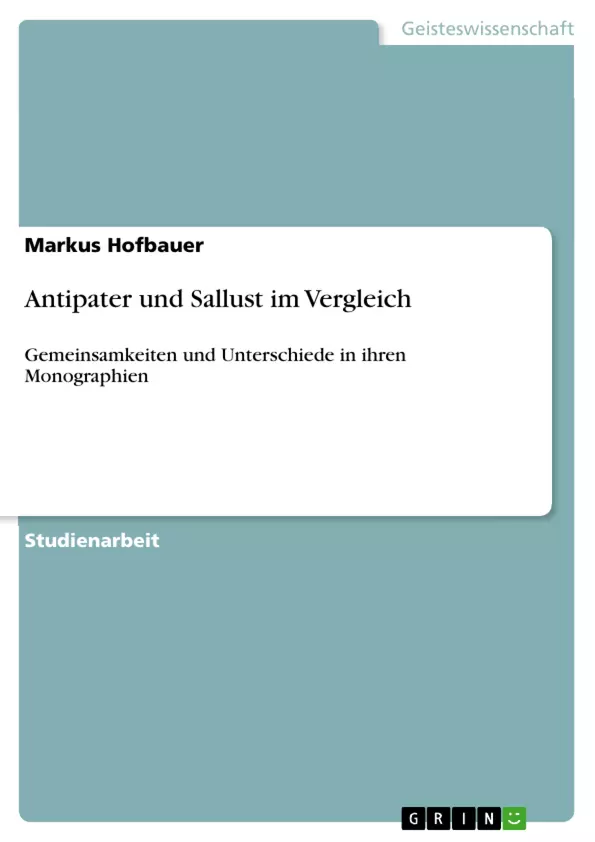Als rhetorische Koryphäe erläutert Cicero in einem Brief an seinen Vertrauten Lucilius die Form, in welcher sein politisches Erbe die Zeiten überdauern sollte: eine monographische Darstellung. Insbesondere seine Vita, die vom Auf- und Abstieg eines homo novus geprägt war, fordere es geradezu heraus, die dramatischen Schicksalsschläge von den übrigen Ereignissen gesondert auszuschöpfen, um dem Rezipienten ein reichhaltiges Lesevergnügen darzubieten. Die Wurzel eben jener skizzierten Anforderungen, die Cicero ein ihm ebenbürtiges, literarisches Antlitz verleihen sollten, erkennt Atticus in de legibus bei den historiae des renommierten Advokaten Coelius Antipater, der dem Zweiten Punischen Krieg in der ersten römischen Monographie ein leuchtendes Denkmal setzte. An dieses Oeuvre knüpfte Sallust, dessen Monographien, die Coniuratio Catilinae und das Bellum Iugurthinum, das „einzige in frischen Farben übrig gebliebene Bild in der sonst völlig verblassten und verwaschenen Tradition dieser Epoche“ darstellen, formal an. Die Gattungswahl begünstigt daher einen Vergleich in den Instrumentarien, um den geschichtlichen Verlauf darzustellen.
Im Folgenden werden zunächst die Proömien behandelt, wobei deren Intention eine herausragende Rolle spielen wird. Dies soll die Grundlage bilden, um in einem nächsten Schritt ausgewählte Elemente der geschichtlichen Ausgestaltung vergleichen und interpretieren zu können. In diesem Punkt ist anzumerken, dass aufgrund der fragmentarischen Überlieferung der historiae, die nach Herrmann zitiert worden sind, eine akribische Untersuchung kaum möglich ist. Schließlich wird das Ende dieser Arbeit ein Fazit zieren, das einen Schluss
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Ausgewählte Elemente der Monographien im Vergleich
- II. 1. Das Proömium
- II. 2. Der Aufbau und die Konzeption
- II. 3. Der stilistische Anspruch und die künstlerische Formgebung
- II. 4. Die orationes fictae
- II. 5. Die Exkurse und Digressionen
- a) Geographische und ethnographische Exkurse
- b) Der Sittenverfall im Exkurs
- II. 6. Die Personenporträts und Charakterentwicklung
- II. 7. Die episodenhaften Erzählungen
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, ausgewählte Elemente der Monographien von Sallust und Coelius Antipater vergleichend zu analysieren und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in ihrer Konzeption, ihrem Aufbau und ihrer stilistischen Gestaltung aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der formalen Gestaltung und der jeweiligen Intention der Autoren.
- Vergleich der Proömien von Sallust und Antipater hinsichtlich ihrer Intention und methodischen Ansätze.
- Analyse des Aufbaus und der Konzeption beider Werke, insbesondere im Hinblick auf die Gewichtung von Haupthandlung und Exkursen.
- Untersuchung der stilistischen Ansprüche und der künstlerischen Formgebung, unter Berücksichtigung der jeweiligen rhetorischen Mittel und Stilmerkmale.
- Beurteilung des Einflusses hellenistischer Literatur auf die Stilistik beider Autoren.
- Bewertung der Bedeutung von Quellenkritik und -nutzung in den jeweiligen Werken.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung erläutert die historischen und literarischen Hintergründe der Untersuchung. Sie führt in die Thematik der römischen Monographie ein, indem sie Ciceros Brief an Lucilius und dessen Ausführungen zur monographischen Darstellung als Grundlage für die spätere Entwicklung dieser Gattung benennt. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei Coelius Antipater und Sallust gewidmet, deren Monographien als zentral für den Vergleich herangezogen werden. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit und umreißt die zu behandelnden Punkte. Die fragmentarische Überlieferung der Historiae von Antipater wird als Limitation des Forschungsansatzes angesprochen.
II. Ausgewählte Elemente der Monographien im Vergleich: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und bietet einen detaillierten Vergleich verschiedener Aspekte der Monographien von Sallust und Antipater. Es behandelt die Proömien, den Aufbau und die Konzeption, den stilistischen Anspruch und die künstlerische Formgebung. Der Vergleich beleuchtet sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in den Intentionen, den Methoden und den stilistischen Mitteln beider Autoren. Der Abschnitt zeigt auf, wie die Autoren jeweils Geschichte erzählten und interpretierten, und analysiert die jeweiligen rhetorischen Strategien und die gewählten Stilmittel. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der philosophischen und politischen Hintergründe der jeweiligen Schreibweisen.
Schlüsselwörter
Römische Monographie, Sallust, Coelius Antipater, Proömium, Aufbau, Stilistik, Rhetorik, Quellenkritik, Historiographie, Hellenismus, Brevitas, Asianismus, Catilinarische Verschwörung, Bellum Iugurthinum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleichende Analyse ausgewählter Elemente der Monographien von Sallust und Coelius Antipater
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert ausgewählte Elemente der Monographien von Sallust und Coelius Antipater vergleichend. Der Fokus liegt auf der formalen Gestaltung und der Intention der Autoren. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Konzeption, Aufbau und stilistischer Gestaltung aufgezeigt.
Welche Elemente der Monographien werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die Proömien, den Aufbau und die Konzeption der Werke, den stilistischen Anspruch und die künstlerische Formgebung, orationes fictae, Exkurse (geographisch, ethnographisch, zum Sittenverfall), Personenporträts und Charakterentwicklung sowie die episodenhaften Erzählungen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Intentionen und methodischen Ansätze der Autoren in ihren Proömien zu vergleichen, den Aufbau und die Konzeption der Werke (Gewichtung von Haupthandlung und Exkursen) zu analysieren, die stilistischen Ansprüche und die künstlerische Formgebung (rhetorische Mittel und Stilmerkmale) zu untersuchen, den Einfluss hellenistischer Literatur auf die Stilistik zu beurteilen und die Bedeutung von Quellenkritik und -nutzung zu bewerten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel mit detailliertem Vergleich verschiedener Aspekte der Monographien (siehe oben), und ein Fazit. Die Einleitung erläutert die historischen und literarischen Hintergründe, den methodischen Ansatz und die Limitationen aufgrund der fragmentarischen Überlieferung der Historiae von Antipater.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Römische Monographie, Sallust, Coelius Antipater, Proömium, Aufbau, Stilistik, Rhetorik, Quellenkritik, Historiographie, Hellenismus, Brevitas, Asianismus, Catilinarische Verschwörung, Bellum Iugurthinum.
Welche Quellen werden besonders berücksichtigt?
Die Monographien von Sallust (z.B. Catilinarische Verschwörung, Bellum Iugurthinum) und Coelius Antipater (Historiae, fragmentarisch überliefert) bilden die zentrale Grundlage des Vergleichs. Ciceros Brief an Lucilius wird als Grundlage für die spätere Entwicklung der monographischen Darstellung genannt.
Welche Limitationen weist die Arbeit auf?
Die fragmentarische Überlieferung der Historiae von Coelius Antipater stellt eine Limitation des Forschungsansatzes dar.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kurzform)?
Das Fazit (Kapitel III) fasst die Ergebnisse des Vergleichs von Sallust und Coelius Antipater zusammen und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen zur Geschichtsschreibung.
- Quote paper
- Markus Hofbauer (Author), 2015, Antipater und Sallust im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/340101