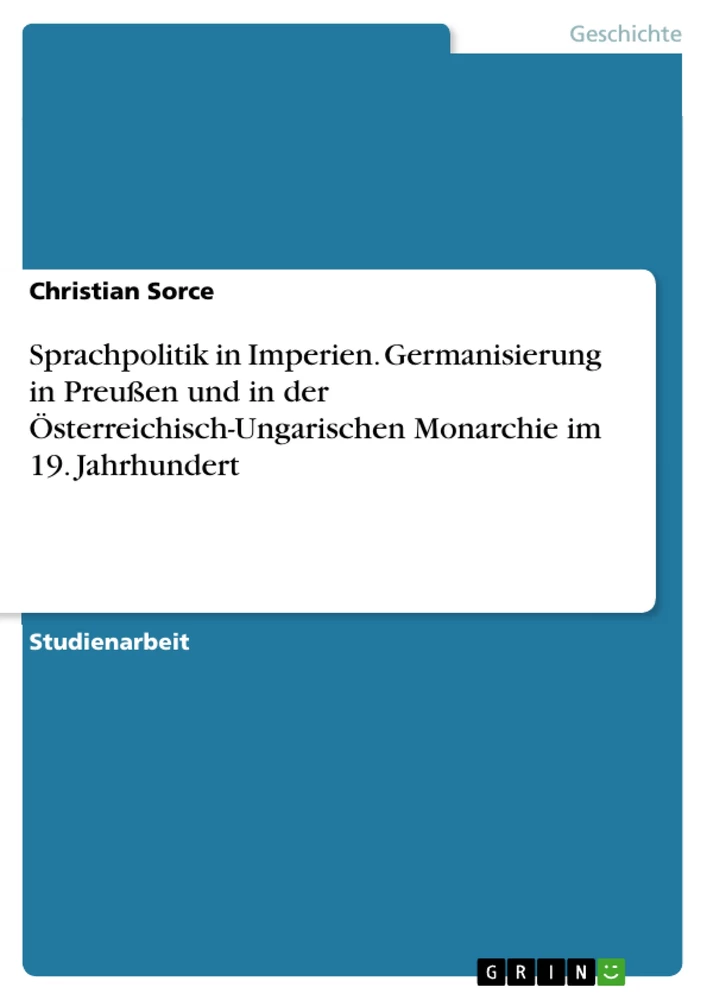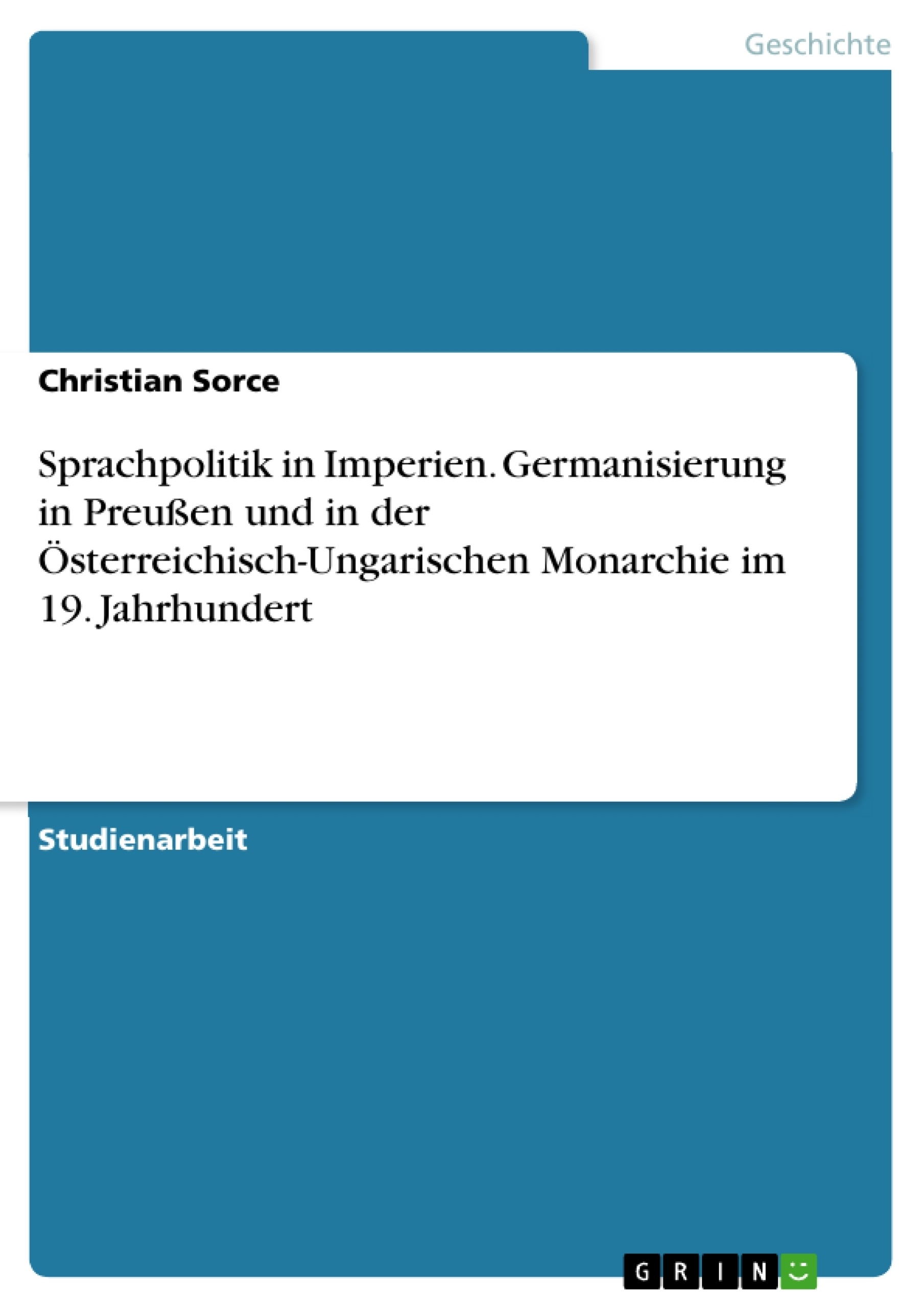Im 19. Jahrhundert ist die Welt gespickt von Imperien, laut Osterhammel gekennzeichnet durch eine multiethnische, pluralistische Gesellschaft, in der es „keine gemeinsame imperiale Kultur“ gibt und in der zentralistische Strukturen herrschen. Damit der Herrschaftsanspruch der Imperialmacht bzw. des Zentrums dauerhaft und nachhaltig gefestigt ist, wird die Freiheit der Menschen durch den Zwangsapparat eingeschränkt. Diese Einschränkung äußert sich auch in einer Sprachpolitik, die die lokale Sprache unterdrückt und durch gesetzliche Maßnahmen versucht, die Sprache der Zentralmacht zunächst in der öffentlichen und dann in der privaten Sphäre durchzusetzen.
Das Europa des 19. Jahrhundert ist jedoch nicht nur aufgrund für seiner geopolitisch-imperialen Struktur bekannt; die Modernisierung hat Europa erreicht, ein gesellschaftlicher Wandel, „der seinen Ursprung in der englischen industriellen Revolution von 1760-1830 und in der politischen Französischen Revolution von 1789-1794 hat […]“ (Bendix, 1969: 506-510, zitiert nach Degele/Dries, 2005: 16). Gegenstand dieser Untersuchung ist der Vergleich zwischen sprachpolitischen Maßnahmen in Preußen und in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Darüber hinaus wird ein Zusammenhang mit der Modernisierung hergestellt: Sind Sprachgesetze und Sprachpolitik ein Mittel, um eine Gesellschaft voranzubringen und zu modernisieren?
In einem weiteren Schritt werden die Maßnahmen untersucht, die in beiden Imperien zur Germanisierung der autochthonen Gesellschaft ergriffen wurden. Erörtert werden die Faktoren, die zum Versagen der österreichischen Sprachpolitik geführt haben. Diese werden in einem weiteren Schritt mit der antipolnischen Sprachpolitik in Preußen verglichen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptinhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die einen Titel, ein Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es analysiert Themen in strukturierter und professioneller Weise.
Was ist das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis listet die folgenden Kapitel auf: 1. Einleitung (Seite 3) 2. Modernisierung (Seite 3) 2.1. Rationalisierung und Bürokratisierung (Seite 4) 3. Preußen und Österreich-Ungarn im 19. Jahrhundert (Seite 5) 3.1. Sprachpolitik in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (Seite 8) 3.2. Sprachpolitik in Preußen (Seite 13) 4. Zusammenfassung (Seite 16) 5. Anhang (Seite 18) 6. Bibliographie (Seite 20) 6.1. Selbständige Veröffentlichungen (Seite 20) 6.2. Unselbständige Veröffentlichungen (Seite 21)
Was wird in der Einleitung diskutiert?
Die Einleitung behandelt die multiethnische und pluralistische Natur von Imperien im 19. Jahrhundert und wie zentrale Strukturen die Freiheit durch Sprachpolitik einschränkten.
Was wird im Kapitel zur Modernisierung behandelt?
Dieses Kapitel definiert Modernisierung als wirtschaftlichen und politischen Fortschritt und erläutert das Schema der Modernisierung in Bezug auf Struktur, Kultur, Natur und Person. Der Fokus liegt auf der Rationalisierung als Teil des Prozesses der Kulturentwicklung.
Was wird unter Rationalisierung und Bürokratisierung verstanden?
Rationalisierung wird als Systematisierung zur Vorhersagbarkeit und Beherrschbarkeit definiert. Bürokratisierung ist ein Mittel zur Rationalisierung, das zur Gesetzesherrschaft und zum Abbau von Willkürherrschaft führt. Dies beinhaltet den Abbau von Freiheit.
Was sind die Hauptthemen im Kapitel über Preußen und Österreich-Ungarn im 19. Jahrhundert?
Dieses Kapitel vergleicht die Sprachpolitik in Preußen und der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und untersucht den Zusammenhang zwischen Sprachgesetzen, Sprachpolitik und Modernisierung. Es werden die Faktoren erörtert, die zum Versagen der österreichischen Sprachpolitik geführt haben, und diese werden mit der antipolnischen Sprachpolitik in Preußen verglichen. Auch wird auf die historischen Ereignisse nach dem Wiener Kongress und deren Auswirkungen auf Preußen und Österreich eingegangen.
Was wird im Kapitel zur Sprachpolitik in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie behandelt?
Das Kapitel beschreibt den Vielvölkerstaat der Habsburgermonarchie und die Rolle der Sprache als Identifikationsfaktor. Es wird auf die nationalistischen Bestrebungen der verschiedenen Sprachgruppen eingegangen, die nach Gleichberechtigung strebten. Die gescheiterte Identitätsstiftung in Österreich-Ungarn wird ebenso analysiert. Hier wird außerdem auf die Bedeutung des Artikels 19 und dessen Umsetzung in der realität eingegangen.
Was wird im Kapitel zur Sprachpolitik in Preußen behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Zurückdrängung der polnischen Sprache in den polnischen Gebieten Preußens. Die Germanisierungspolitik wird erörtert. Preußen, als Staat zwischen den Nationen, wird im Kontext der Sprachpolitik betrachtet.
Was ist die Zusammenfassung des Textes?
Der Text fasst die Erkenntnisse bezüglich Germanisierungsmaßnahmen und den Unterschieden in Preußen und Österreich-Ungarn zusammen. Es wird betont, dass die Sprachpolitik den Nationalitätenkampf schürte und somit eine einheitliche Modernisierung verhinderte.
- Quote paper
- Christian Sorce (Author), 2010, Sprachpolitik in Imperien. Germanisierung in Preußen und in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/339249