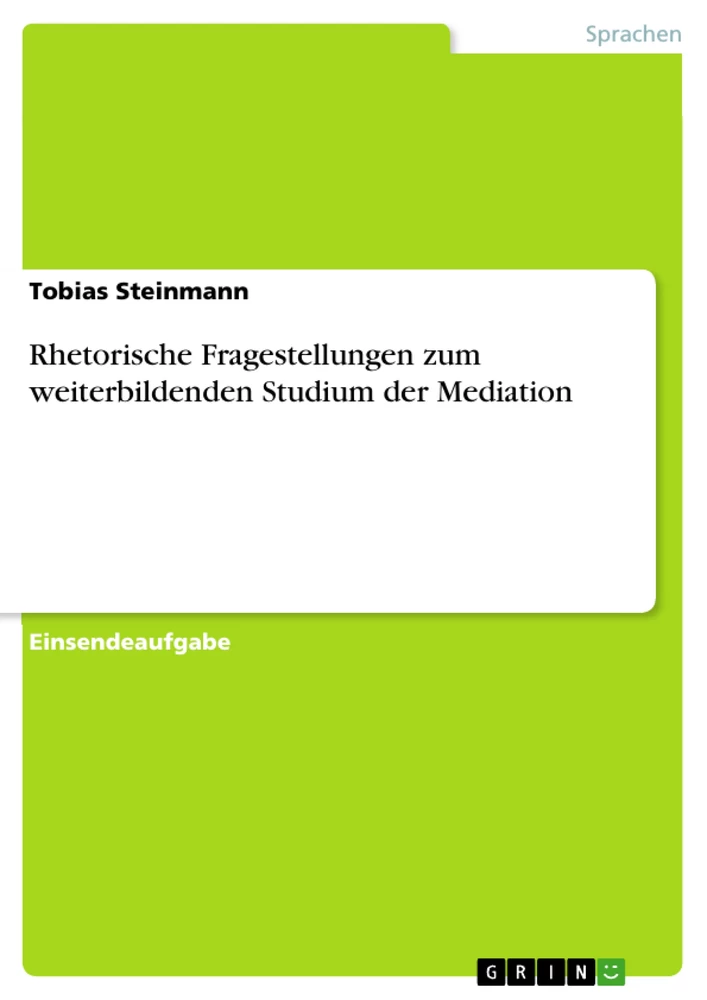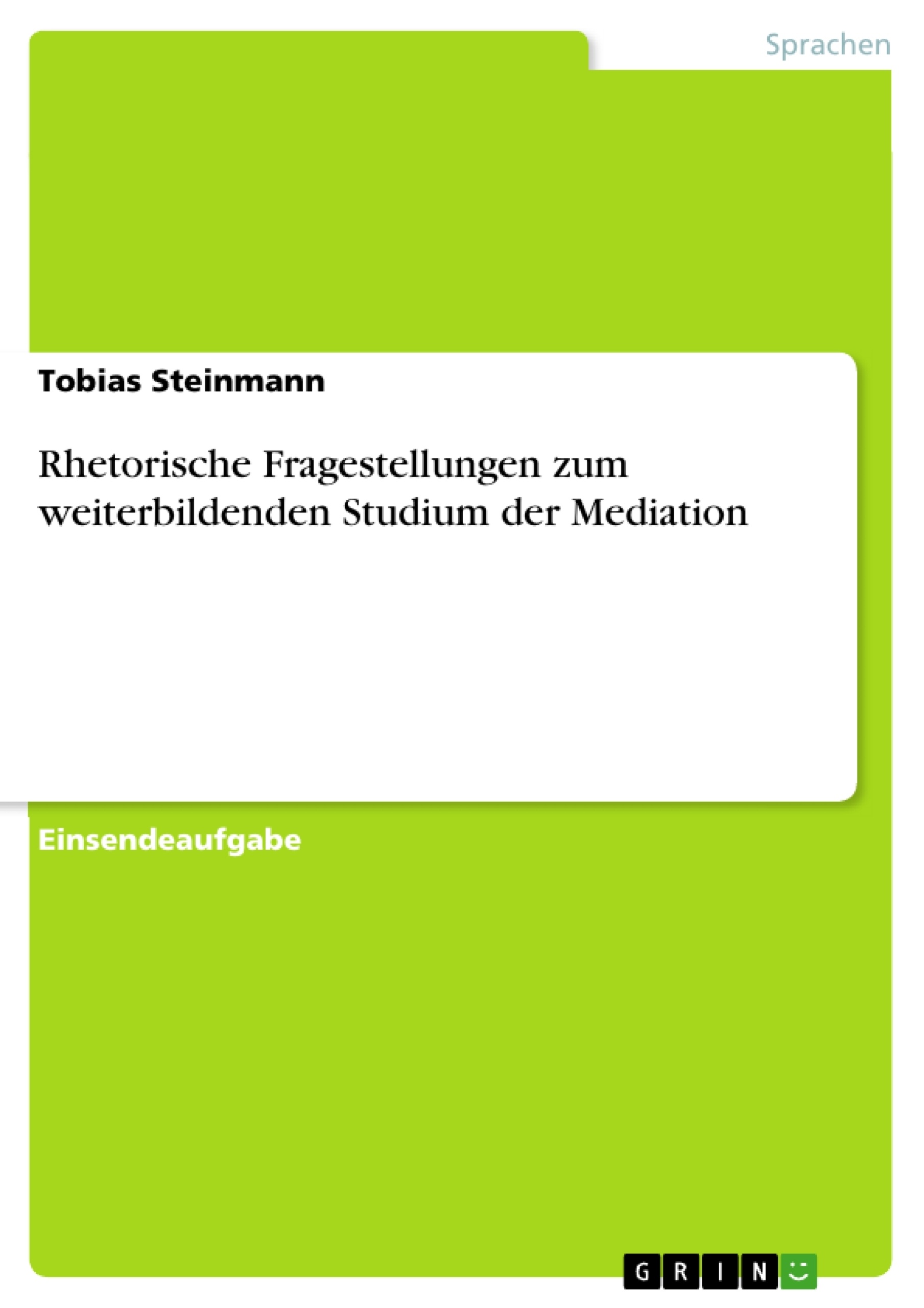Diese Einsendearbeit befasst sich mit Fragestellungen rund um das große Thema Rhetorik innerhalb der Mediation.
1)
a) Auf welche Emotionen und Gedanken des Medianden M könnten die in den Beispielen 1 und 2 beschriebenen Verhaltensänderungen hindeuten?
b) Wie verhalten Sie sich als Mediator konkret, um mit den geschilderten Verhaltensänderungen angemessen umzugehen?
2) Wie können Sie (als Mediator) nonverbal auf den Verlauf einer Mediation positiv einwirken?
3) Erläutern Sie die fünf Phasen der Redevorbereitung
4) Warum ist es bei der Themensammlung in der zweiten Phase einer Mediation so wichtig, dass der Mediator die Themen der Medianden möglichst neutral formuliert? Drei Beispiele für ein Thema eines Medianden und das durch den Mediator neutral formulierte Pendant
5) Schildern Sie bitte die Vor- und Nachteile des intuitiven und rationalen Verhandelns
6) Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Auf welche Emotionen und Gedanken des Medianden M könnten die in den Beispielen 1 und 2 beschriebenen Verhaltensänderungen hindeuten?
- Grundsätzlich gilt: Körpersprache, also körperliche Signale sind niemals wirklich eindeutig.
- Am Beispiel des Medianden M kann die Veränderung der Körperhaltung, hier nach vorn geneigt, im Beispiel 1 möglicherweise darauf hindeuten, dass ein gesteigertes Interesse vorliegt, er sich ggf. zu Wort melden möchte (Positive Ambivalenz) oder eventuell auch darauf, dass er Einwände hat und unterbrechen möchte (Negative Ambivalenz).
- Im Beispiel 2 kann das Zurücklehnen mit Abwarten (positive Ambivalenz) assoziiert werden, denkbar wäre auch eine ablehnende Haltung (negative Ambivalenz).
- Wie können Sie (als Mediator) nonverbal auf den Verlauf einer Mediation positiv einwirken?
- Erläutern Sie die fünf Phasen der Redevorbereitung.
- Warum ist es bei der Themensammlung in der zweiten Phase einer Mediation so wichtig, dass der Mediator die Themen der Medianden möglichst neutral formuliert? Drei Beispiele für ein Thema eines Medianden und das durch den Mediator neutral formulierte Pendant… ………………………..\n
- Schildern Sie bitte die Vor- und Nachteile des intuitiven und rationalen Verhandelns.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Bedeutung nonverbaler Kommunikation im Mediationsprozess und wie diese gezielt eingesetzt werden kann, um den Verlauf der Mediation positiv zu beeinflussen.
- Die Interpretation von Körpersprache und deren Ambivalenz
- Der Einfluss nonverbaler Kommunikation auf das Mediationsgeschehen
- Die Bedeutung der eigenen Körperhaltung als Mediator
- Methoden zur nonverbalen Beeinflussung in der Mediation
- Die Anwendung von Pacing und Leading im Mediationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit der Interpretation von nonverbalen Signalen und deren Ambivalenz. Es werden konkrete Beispiele aus dem Mediationsprozess aufgezeigt und deren mögliche Deutungen analysiert.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Bedeutung nonverbaler Kommunikation für den Mediator und wie diese gezielt eingesetzt werden kann, um eine positive Atmosphäre zu schaffen und den Verlauf der Mediation zu beeinflussen.
- Das dritte Kapitel erläutert die fünf Phasen der Redevorbereitung und deren Bedeutung für den Erfolg der Mediation.
- Das vierte Kapitel beleuchtet die Bedeutung der neutralen Formulierung von Themen durch den Mediator und gibt Beispiele für die Umsetzung in der Praxis.
- Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Vor- und Nachteilen des intuitiven und rationalen Verhandelns und deren Relevanz im Mediationsprozess.
Schlüsselwörter
Nonverbale Kommunikation, Mediation, Körpersprache, Ambivalenz, Pacing, Leading, Konfliktmanagement, Redevorbereitung, Themenformulierung, Verhandlungsstrategien.
- Quote paper
- Tobias Steinmann (Author), 2016, Rhetorische Fragestellungen zum weiterbildenden Studium der Mediation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/339188