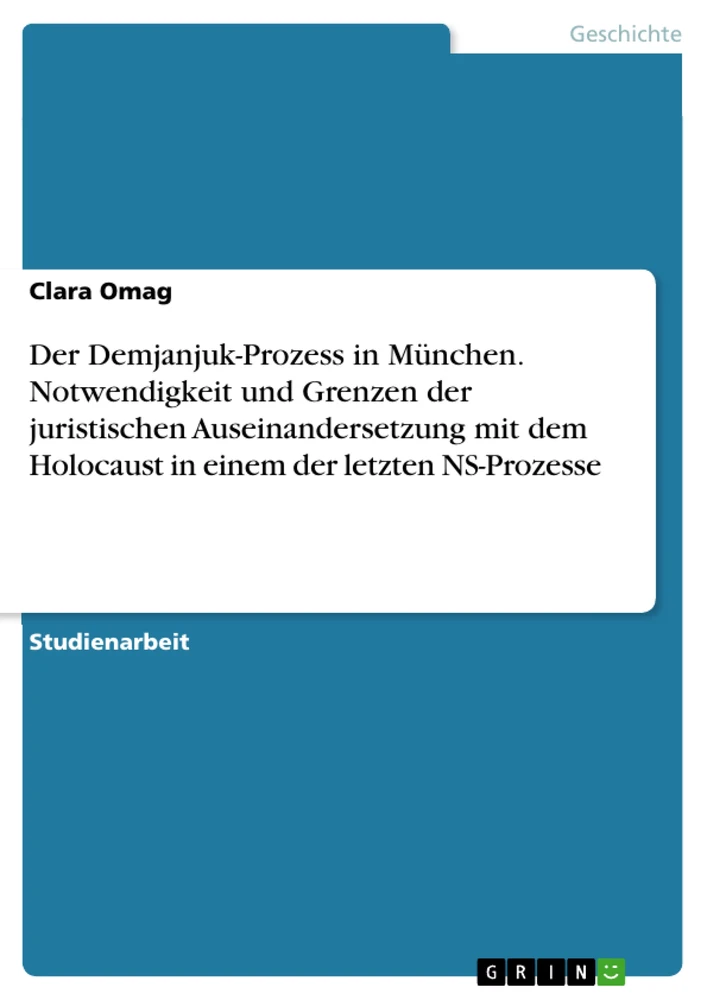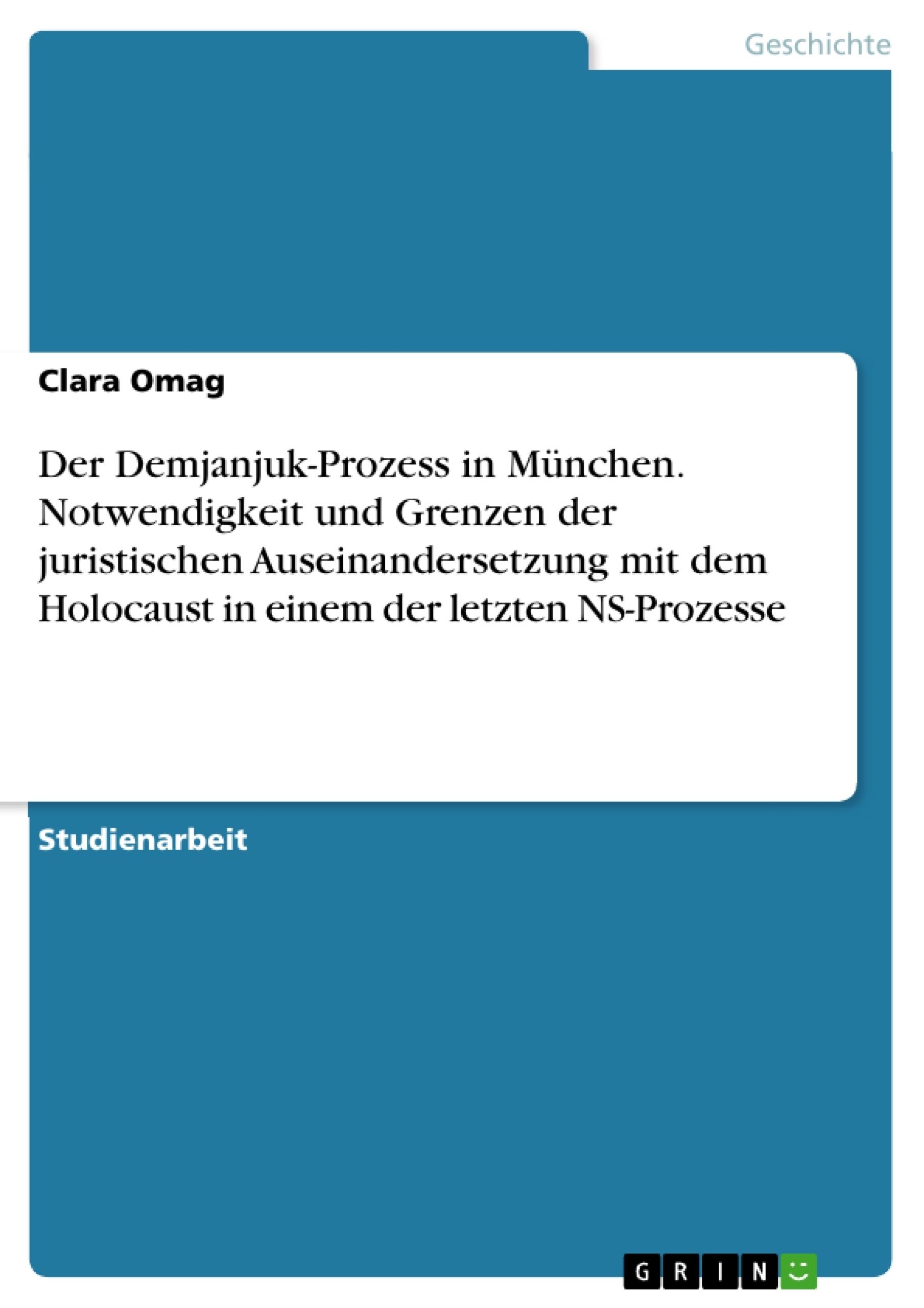Vom 30. November 2009 bis zum 12. Mai 2011 fand vor dem Landesgericht in München der Prozess gegen Iwan Demjanjuk statt. Wie in so vielen früheren NS-Prozessen standen Fragen nach dem Umgang mit dem Holocaust, gesellschaftliche Erwartungen und mediale Interessen auf der Tagesordnung. Der Angeklagte: ein fast neunzigjähriger staatenloser Greis.
Über 60 Jahre nach Kriegsende steht nochmals ein mutmaßlicher NS-Täter vor einem deutschen Gericht. Noch einmal wird die Geschichte der Judenvernichtung vor die Augen der Menschheit gebracht, noch einmal rechnet Deutschland mit seiner Vergangenheit ab. Aber wozu soll dieses verspätete Verfahren noch gut sein? Die meisten Zeugen sind verstorben, Erinnerungen verblassen und belastende Dokumente gingen verloren. So stößt der Demjanjuk-Prozess in München immer wieder an die Grenzen des Rechts und des Rechtsgefühls, könnte es doch das letzte Mal sein, dass Gerichte mit dem Völkermord konfrontiert werden. So zeigt diese Verhandlung wie keine andere die Notwendigkeit und die Grenzen der justiziellen Aufarbeitung des Holocaust.
Worin liegt der Sinn heutiger NS-Prozesse? Was erwarten sich Anwälte, Richter und Zuschauer? Wie definiert sich Deutschland im Hinblick auf die NS-Zeit? Und wo liegen die Grenzen der Rechtsprechung? In folgender Arbeit sollen diese Fragen vor dem Hintergrund des Demjanjuk-Prozesses, der deutschen Nachkriegsjustiz und der Geschichte des Holocaust genauer beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HINTERGRÜNDE DES MÜNCHENER PROZESSES GEGEN DEMJANJUK
- Wer war John (Iwan) Demjanjuk?
- Anzeige gegen Demjanjuk – die Grenzen des Rechts
- Sobibór und die Logik der Anklage
- DER PROZESS - GRENZEN UND SINNHAFTIGKEIT DES RECHTS
- Die deutsche Nachkriegsjustiz: Lücken, Versäumnisse und Schwierigkeiten
- Sinnhaftigkeit heutiger NS-Verfahren im Spiegel des Demjanjuk-Prozesses
- Das Urteil und der Versuch einer Bilanz
- SCHLUSSBEMERKUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Demjanjuk-Prozess, der im Jahr 2009 in München begann. Der Prozess, der über 60 Jahre nach Kriegsende stattfand, befasst sich mit dem Thema der juristischen Aufarbeitung des Holocaust. Im Vordergrund steht dabei die Frage nach der Sinnhaftigkeit und den Grenzen der Rechtsprechung im Umgang mit NS-Verbrechen in einer Zeit, in der die meisten Zeitzeugen verstorben sind und Dokumente verloren gegangen sind.
- Die deutsche Nachkriegsjustiz und ihre Schwierigkeiten bei der Aufarbeitung von NS-Verbrechen
- Die Grenzen des Rechts und des Rechtsgefühls im Umgang mit dem Holocaust
- Die Rolle der Medien und gesellschaftlichen Erwartungen im Kontext von NS-Prozessen
- Der Lebensweg John (Iwan) Demjanjuks und seine mögliche Rolle im Vernichtungslager Sobibór
- Die Frage nach der Verantwortung und der Schuld von Tätern und Mittätern im Holocaust
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Demjanjuk-Prozess vor und beleuchtet die besondere Bedeutung des Prozesses in Anbetracht der langen Zeitspanne seit Kriegsende. Es werden die zentralen Fragen des Prozesses aufgeworfen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Hintergründen des Münchener Prozesses. Es wird die Biografie John (Iwan) Demjanjuks vorgestellt und seine mögliche Rolle im Vernichtungslager Sobibór beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert den Prozess selbst und befasst sich mit den Grenzen und der Sinnhaftigkeit der Rechtsprechung im Umgang mit NS-Verbrechen. Es wird die deutsche Nachkriegsjustiz beleuchtet und die Schwierigkeiten bei der Verfolgung von NS-Tätern hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind der Demjanjuk-Prozess, die juristische Aufarbeitung des Holocaust, die deutsche Nachkriegsjustiz, die Grenzen des Rechts, die Rolle der Medien, der Lebensweg John (Iwan) Demjanjuks und die Frage nach der Verantwortung und Schuld im Holocaust.
- Quote paper
- Clara Omag (Author), 2012, Der Demjanjuk-Prozess in München. Notwendigkeit und Grenzen der juristischen Auseinandersetzung mit dem Holocaust in einem der letzten NS-Prozesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/338993