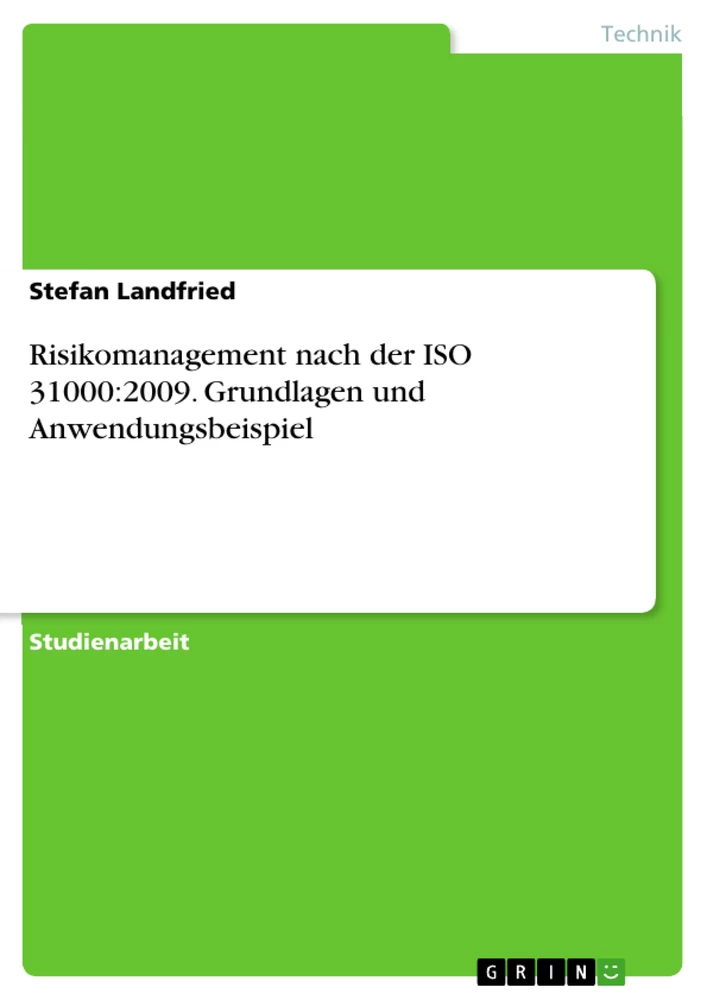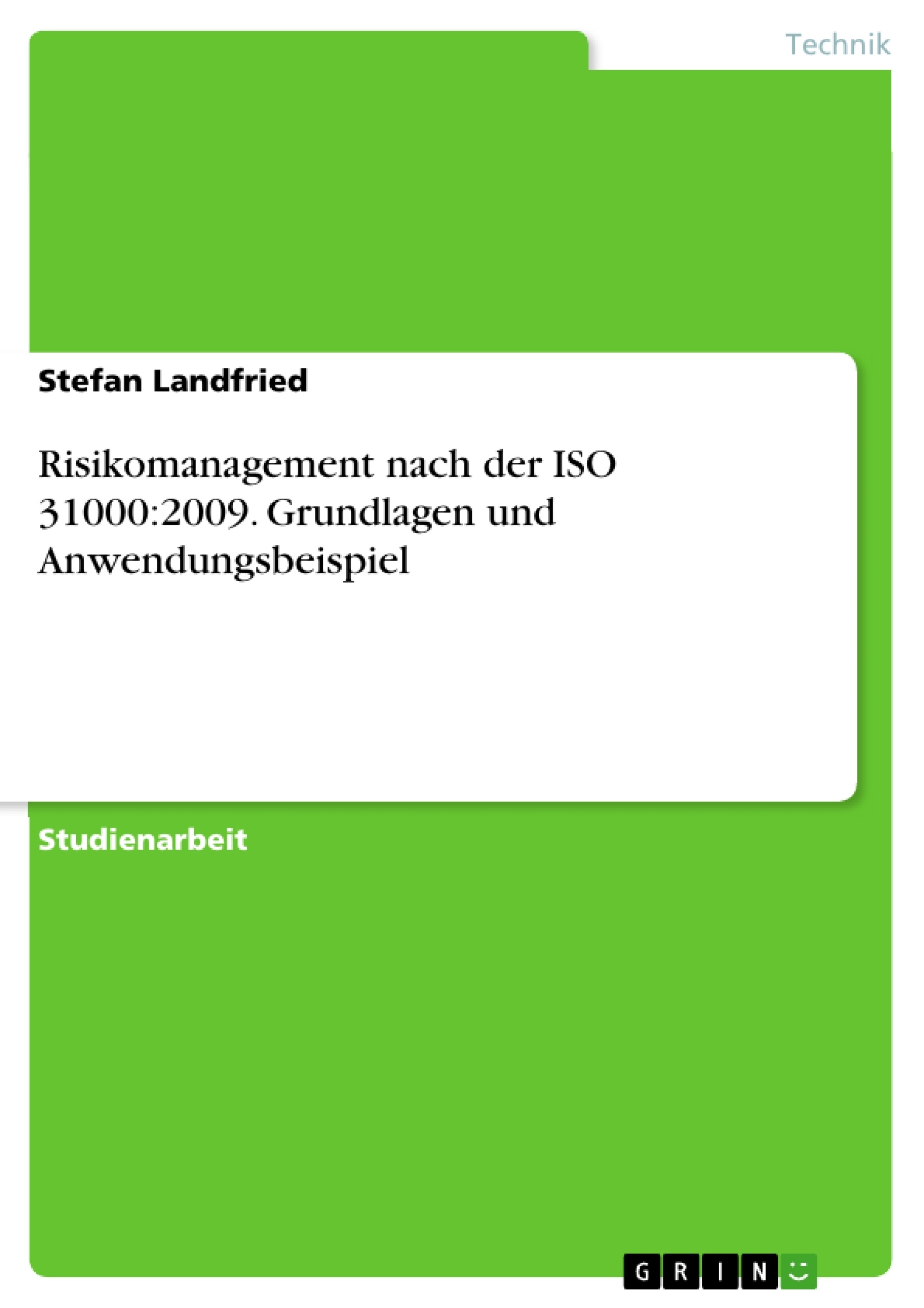Für ein Unternehmen ist es bei jedem Vorgehen fatal zu handeln, ohne zu Beginn die Ziele und Risiken zu kennen oder zu bedenken. Das Soll-Risikomanagement eines Unternehmens baut auf diesem Grundgedanken auf und hat sich in Großunternehmen bereits weitgehend etabliert. Aber auch für kleine und mittelständische Unternehmen gewinnt das Risikomanagement zunehmend an Bedeutung und stellt ein betriebswirtschaftliches Instrument zur Risikobewältigung dar. Dieses Streben wird verstärkt durch die wachsende Zahl von Vorschriften, Regelwerken und Normen, welche auch diese Unternehmensgrößen verstärkt betreffen.
Das allgemein vorherrschende Problem betreffend des Risikomanagements in Unternehmen ist, dass ohne ein einheitliches Regelwerk, jeder seine eigene Vorgehensstruktur aufbaut. Durch ein ungeregeltes Vorgehen oder einer einheitlichen Struktur, können Themen oder wichtige Risikopunkte untergehen. Auch Vergleiche von Unternehmensteilen oder Unternehmen untereinander ist in diesem Bereich schwer zu realisieren, wenn kein einheitliches Vorgehen vorliegt. Dies erschwert den Erfahrungsaustausch erheblich.
Ein weltweit geltendes Regelwerk, das eine verbindliche Leitlinie für das Risikomanagement für Unternehmensrisiken darstellt, wurde am 15. November 2009 veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um die internationale Norm ISO 31000:2009 „Risk management - Principles and guidelines“. Diese soll nicht nur großen Organisationen helfen, die Spezialisierung des Risikomanagements zu bewältigen sondern auch KMU und ist somit unabhängig von der Unternehmensart und -größe. Denn spätestens seit den enormen internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen tangieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Begründung der Themenstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlagen und Begriffsabgrenzung
- 2.1 ISO 31000:2009
- 2.2 Risikomanagement
- 3. Risikomanagementprozess nach ISO 31000
- 4. Anwendungsbeispiel der ISO 31000 anhand eines Kleinunternehmens
- 4.1 Unternehmensbeschreibungen
- 4.2 Umsetzung der ISO 31000 an der SKM GmbH
- 5. Fazit und kritische Reflektion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Grundlagen des Risikomanagements nach der ISO 31000:2009. Sie analysiert die wichtigsten Aspekte des Standards und illustriert die Prozesse und Methoden anhand eines Anwendungsbeispiels. Das Ziel ist es, die Bedeutung und Relevanz des Risikomanagements für Kleinunternehmen aufzuzeigen und die Anwendung der ISO 31000 in der Praxis zu verdeutlichen.
- Die ISO 31000:2009 als internationaler Standard für Risikomanagement
- Die Bedeutung des Risikomanagements für Kleinunternehmen
- Der Risikomanagementprozess nach ISO 31000
- Anwendungsbeispiel der ISO 31000 in einem fiktiven Kleinunternehmen
- Kritische Reflektion der ISO 31000 und ihrer Anwendung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik des Risikomanagements ein und begründet die Relevanz der ISO 31000:2009 für Unternehmen. Kapitel 2 definiert wichtige Begriffe und grenzt die Bedeutung des Risikomanagements ein. Kapitel 3 stellt den Risikomanagementprozess nach ISO 31000 dar und erläutert die einzelnen Schritte. Kapitel 4 zeigt anhand eines fiktiven Kleinunternehmens die praktische Anwendung der ISO 31000.
Schlüsselwörter
Risikomanagement, ISO 31000:2009, Kleinunternehmen, Standards, Prozesse, Methoden, Anwendungsbeispiel, Unternehmensrisiken, Risikobewertung, Risikosteuerung.
- Quote paper
- Stefan Landfried (Author), 2016, Risikomanagement nach der ISO 31000:2009. Grundlagen und Anwendungsbeispiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/338524