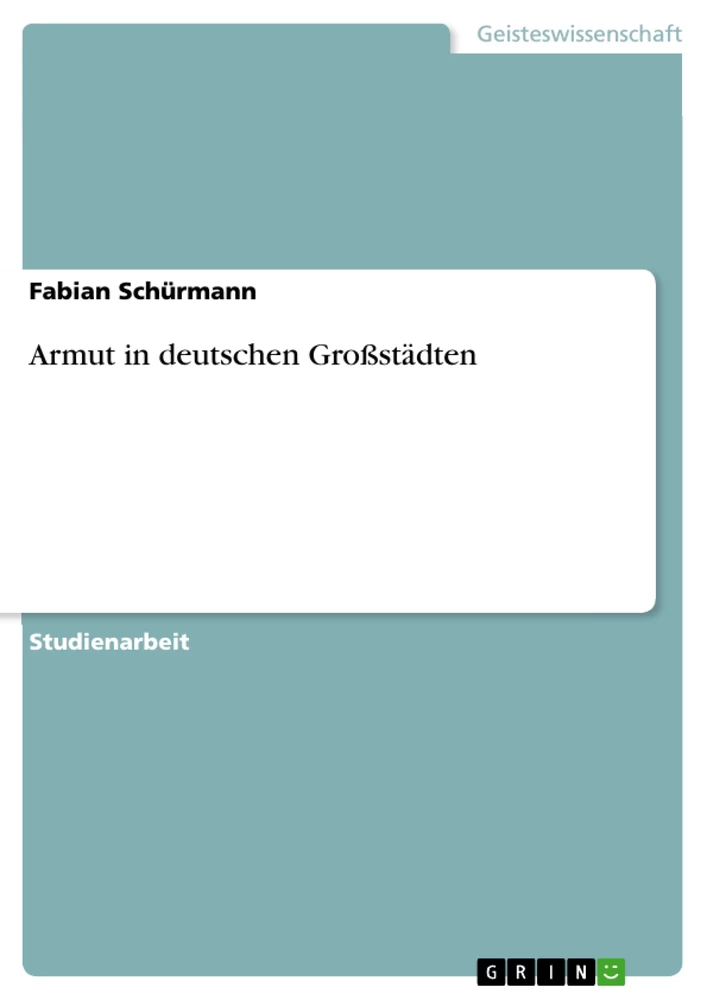In Deutschland existieren große Mengen an privaten Vermögen und das Land gilt als eine der führenden Wirtschaftsnationen. Die Börse boomt - Aktienkauf ist schon fast zum Volkssport geworden und alle Aktiengesellschaften versprechen riesige Wachstumsmärkte und damit auch hohe Kurssteigerungen. Selbst mit Aktien von Gesellschaften, die noch keinen Gewinn erwirtschaftet haben, lassen sich große Gewinne erzielen. Einige Medien wollen einem fast schon suggerieren, dass man selber Schuld ist, wenn man noch nicht reich ist, da man an der Börse doch ganz schnell sein Kapital vermehren kann.
Wie sich die Wissenschaft, speziell die Soziologie mit diesem Thema seit dem Ende des zweiten Weltkrieges auseinander gesetzt hat, soll im ersten Abschnitt dieser Arbeit behandelt werden. Dabei wird sich zeigen, dass die Euphorie des Wirtschaftswunders den Blick auf die Armutsproblematik behindert hat. Lange Zeit ging man davon aus, dass alle Schichten relativ gleichmäßig vom steigenden gesellschaftlichen Wohlstand profitieren. Als sich anbahnte, dass diese Hoffnung nicht erfüllt werden würde, begann man neue Konzepte für die Messung von Armut zu entwickeln; teilweise besann man sich dabei auch auf ältere, schon existierende Konzepte, die weiterentwickelt wurden. Dieser Vorgang wird im Kapitel "Definitionen von Armut" näher beleuchtet.
Daran anschließend sollen diese Ergebnisse auf das Thema Stadt übertragen werden. Als erstes werde ich dabei eine mehr deskriptiv gehaltene Erläuterung geben, wie Armut in Städten und Armut von Städten festgestellt werden kann. Dabei spielen die Faktoren Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe und Verschuldung die wesentlichen Rollen.
Der Frage, ob man die dadurch festgestellte "Armut im Wohlstand" auch durch die von Jens Dangschat formulierte These "Armut durch Wohlstand" ersetzen, bzw. erweitern kann, werde ich im Anschluss nachgehen.
Als Letztes soll dann noch mal den Folgen der zunehmenden Armut für die Stadtplanung und Gestaltung nachgegangen werden. Befinden wir uns in einer Entwicklung, in der sich Stadtviertel immer mehr voneinander abgrenzen? In der sich die Wohnviertel der "Reichen" durch private Sicherheitsdienste und Videoüberwachung immer mehr abschotten, während auf der anderen Seite ghettoähnliche Viertel entstehen, in denen sich Armut, Kriminalität und Drogen ausbreiten? Überlegungen dazu sind im Kapitel ,,Die räumliche Konzentration von Armut" zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Die deutsche Armutsforschung
- 2 Definitionen von Armut
- 2.1 Absolute und relative Armut
- 2.2 Der Ressourcenansatz
- 2.3 Der Lebenslagenansatz
- 3. Armut in Städten
- 3.1 Arbeitslosigkeit
- 3.2 Sozialhilfedichte
- 3.3 Ausgaben für Sozialhilfe
- 3.4 Kommunale Verschuldung
- 4 Ursachen der Armut in Städten
- 5 Die räumliche Konzentration von Armut
- 6 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Armut in deutschen Großstädten. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung der deutschen Armutsforschung seit dem Zweiten Weltkrieg zu beleuchten, verschiedene Definitionen von Armut zu erläutern und die Ursachen sowie Auswirkungen von Armut in städtischen Kontexten zu analysieren. Die Arbeit untersucht außerdem die räumliche Konzentration von Armut und beleuchtet die Folgen für die Stadtplanung und -gestaltung.
- Entwicklung der deutschen Armutsforschung
- Definitionen von Armut
- Armut in Städten
- Ursachen der Armut in Städten
- Räumliche Konzentration von Armut
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort führt in das Thema Armut in deutschen Großstädten ein und stellt die Forschungsfrage in den Kontext des gesellschaftlichen Wohlstands. Kapitel 1 beleuchtet die Entwicklung der deutschen Armutsforschung seit dem Zweiten Weltkrieg, wobei die Fokussierung auf das Thema Armut in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg und der Einfluss des Wirtschaftswunders hervorgehoben werden. Kapitel 2 widmet sich verschiedenen Definitionen von Armut, darunter absolute und relative Armut sowie der Ressourcen- und Lebenslagenansatz. Kapitel 3 untersucht das Phänomen der Armut in Städten, wobei Arbeitslosigkeit, Sozialhilfedichte, Ausgaben für Sozialhilfe und kommunale Verschuldung als wesentliche Faktoren betrachtet werden. Kapitel 4 befasst sich mit den Ursachen der Armut in Städten und Kapitel 5 mit der räumlichen Konzentration von Armut und den Folgen für die Stadtplanung und -gestaltung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen und Konzepte wie Armutsforschung, Definitionen von Armut, Armut in Städten, Ursachen von Armut, räumliche Konzentration von Armut, Stadtplanung und -gestaltung, Wohlfahrtsstaat, Sozialhilfe, Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit. Die Untersuchung greift auf verschiedene theoretische Ansätze zurück, darunter der Ressourcenansatz, der Lebenslagenansatz und die These der "Armut durch Wohlstand".
- Arbeit zitieren
- Fabian Schürmann (Autor:in), 2001, Armut in deutschen Großstädten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/3355