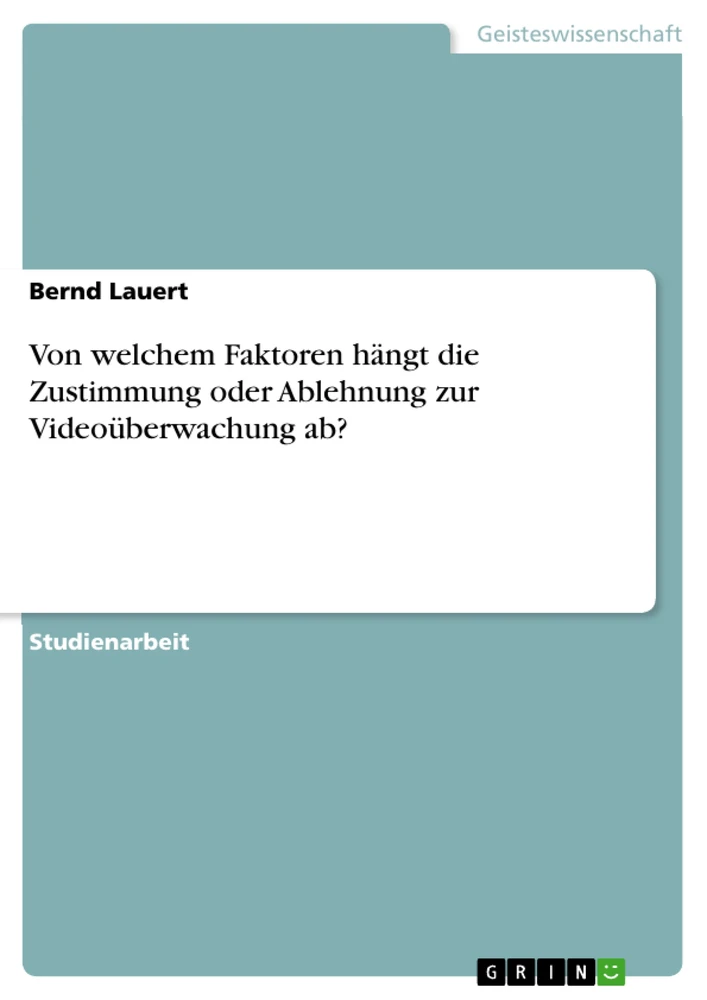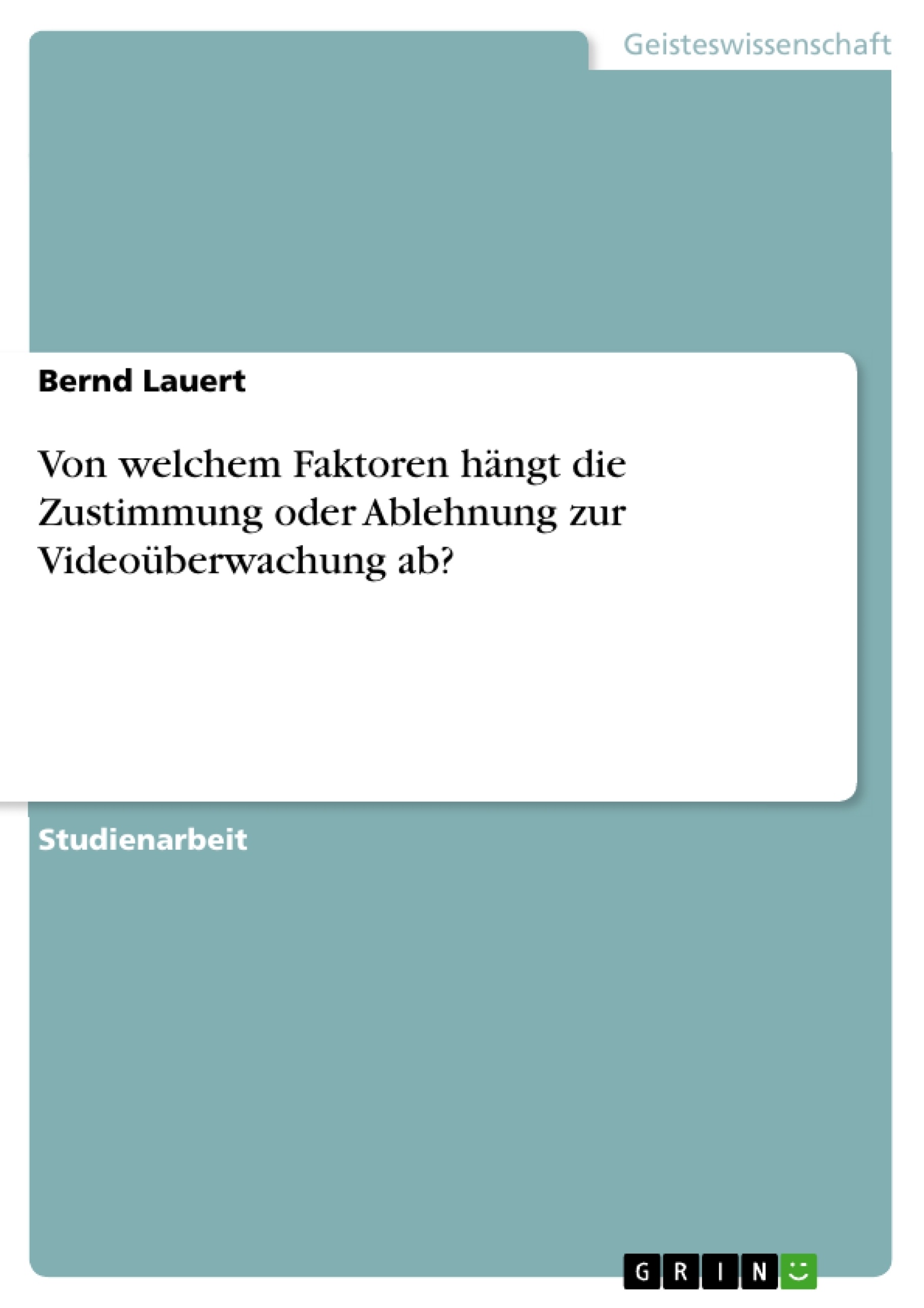Debatten zur Videoüberwachung sind in den letzten Jahren Bestandteil der medialen Öffentlichkeit geworden. Aus diesem Grund ist es unerlässlich herauszufinden, von welchen demografischen Variablen wie Alter, Bildung oder Geschlecht die Zustimmung beziehungsweise die Ablehnung von Videoüberwachung öffentlicher Räume abhängt.
In dieser Arbeit wurden mithilfe eines eigens erhobenen Datensatzes diese demografischen Merkmale isoliert. Des Weiteren wurde verschiedene Einstellunsgmerkmale mit dazugezogen, wie die eigene Überzeugung, selbst bald Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden (persönliche Erwartung viktimisiert zu werden) oder das Vertrauen in die Effektivität von Videoüberwachung. Mithilfe einer multiplen Regressionsanalyse wurden die signifikanten Werte isoliert und benannt.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Videoüberwachung
- 2. Videoüberwachung als Einstellungsobjekt
- 3. Datensatzbeschreibung
- 4. Deskriptive Befunde
- 5. Multivariate Regressionsanalyse
- 6. Entscheidung über die Hypothesen
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Forschungsbericht untersucht die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger zur Videoüberwachung öffentlicher Räume. Ziel ist es, die Faktoren zu analysieren, die die Zustimmung oder Ablehnung zur Videoüberwachung beeinflussen.
- Die Bedeutung von Effektivitätsüberzeugungen und subjektiven Sicherheitsempfinden für die Einstellung zur Videoüberwachung
- Der Einfluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und des Datenschutzes
- Der Einfluss des zunehmenden alltäglichen Nutzens von Videotechnik
- Die Relevanz von Habitualisierung und Zugänglichkeitstheorie für die Einstellungsbildung
- Die vergleichende Betrachtung der Zustimmung zur Videoüberwachung in Ost- und Westdeutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Forschungsbericht stellt die aktuelle Debatte zur Videoüberwachung in Deutschland dar und beleuchtet die Kontroversen um deren Ausweitung. Zudem werden die mangelnde wissenschaftliche Evidenz zur Effektivität von Videoüberwachung und die Bedeutung des subjektiven Sicherheitsempfindens hervorgehoben.
- Videoüberwachung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die aktuelle Situation der Videoüberwachung in Deutschland und zeigt die verschiedenen Einsatzbereiche auf.
- Videoüberwachung als Einstellungsobjekt: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene theoretische Modelle, die die Entstehung von Einstellungen und deren Einfluss auf Verhalten erklären. Besonderes Augenmerk liegt auf den Theorien von Fishbein & Ajzen (1985) und Fazio (2000) zur Einstellungsbildung.
- Datensatzbeschreibung: Dieses Kapitel erläutert die Datenbasis und die Methodik der Studie. Es werden die relevanten Variablen und die verwendete Erhebungsmethode vorgestellt.
- Deskriptive Befunde: Dieses Kapitel präsentiert die deskriptiven Ergebnisse der Studie, die die Einstellungen zur Videoüberwachung in Leipzig aufzeigen. Die Ergebnisse werden mithilfe von Tabellen und Grafiken veranschaulicht.
- Multivariate Regressionsanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die Ergebnisse der multivariaten Regressionsanalyse, die den Einfluss verschiedener Variablen auf die Einstellung zur Videoüberwachung untersucht.
- Entscheidung über die Hypothesen: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse der Regressionsanalyse im Hinblick auf die in Kapitel 2 aufgestellten Hypothesen. Die Ergebnisse werden interpretiert und auf ihre theoretische Relevanz untersucht.
Schlüsselwörter
Videoüberwachung, Einstellung, Sicherheitsempfinden, Datenschutz, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Habitualisierung, Zugänglichkeit, Regressionsanalyse, Leipzig
- Quote paper
- Bernd Lauert (Author), 2014, Von welchem Faktoren hängt die Zustimmung oder Ablehnung zur Videoüberwachung ab?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/334679