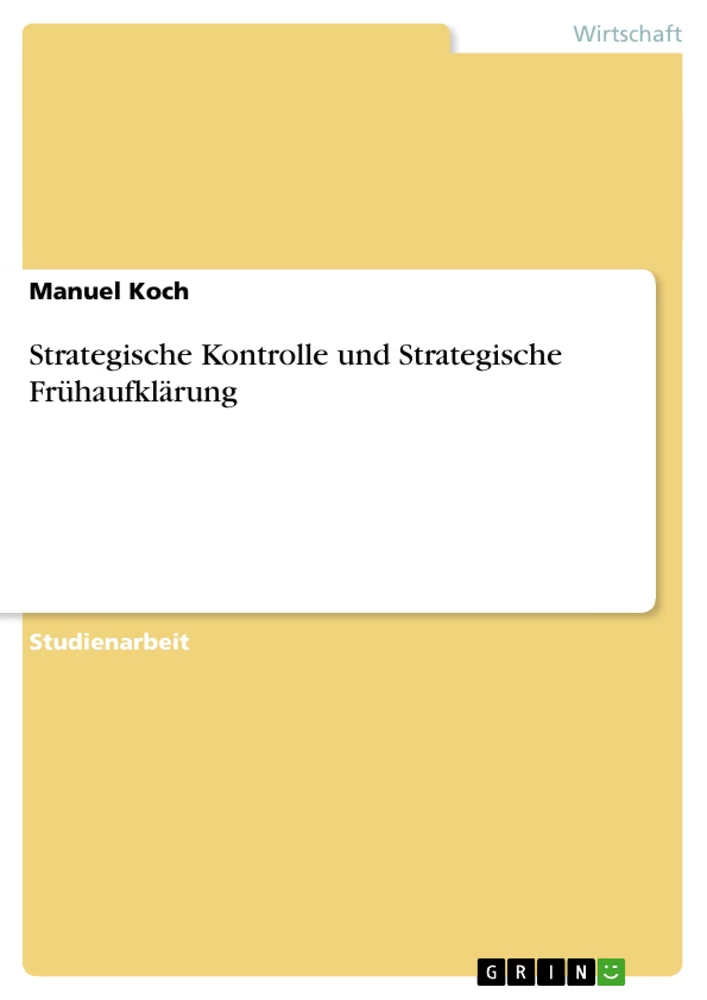Im Zuge der zunehmenden Komplexität und Dynamik des Umfeldes von Unternehmen sind die Anforderungen an das strategische Management stark angestiegen. Kürzere Produktlebenszyklen, die hohe Wechselneigung der Konsumenten und die ausgeprägte Flexibilität und Imitationsfreude der Konkurrenz haben zur Folge, dass sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile kaum noch realisieren lassen. Was heute als viel versprechende Strategie betrachtet wird, kann morgen durch ein unerwartet eingetretenes Ereignis wieder obsolet sein. Unter den sich ständig wandelnden unternehmungsinternen und -externen Bedingungen verliert eine Vielzahl der herkömmlichen, quantitativen Prognosemethoden, die auf der Verarbeitung von Ist-Daten basieren, ihre Aussagekraft.
Vor diesem Hintergrund wird die Frage nach einem geeigneten Instrumentarium laut, das es ermöglicht, strategisch relevante Informationen über anstehende Entwicklungen frühzeitig zu ermitteln und somit eine permanente Anpassungsfähigkeit der Unternehmung zu gewährleisten. Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, mit der Darstellung ausgewählter Konzepte der strategischen Kontrolle und der strategischen Frühaufklärung theoretische Ansätze zur Lösung dieser Aufgabe aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Darstellung des Konzeptes der strategischen Kontrolle
- Notwendigkeit der Kontrolle strategischer Pläne
- Abgrenzung zwischen traditioneller und strategischer Kontrolle
- Elemente eines strategischen Kontrollsystems
- Prämissenkontrolle
- Durchführungskontrolle
- Strategische Überwachung
- Darstellung des Konzeptes der strategischen Frühaufklärung
- Funktionen der strategischen Frühaufklärung
- Entwicklungsstufen strategischer Frühaufklärungssysteme
- Kennzahlensysteme und Planungshochrechnungen
- Indikatorensysteme
- Frühaufklärungssysteme auf Basis der Analyse schwacher Signale
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieses Beitrags ist es, anhand ausgewählter Konzepte der strategischen Kontrolle und der strategischen Frühaufklärung theoretische Ansätze zur Lösung der Problematik der Anpassungsfähigkeit von Unternehmen in einem komplexen und dynamischen Umfeld aufzuzeigen.
- Notwendigkeit einer strategischen Kontrolle aufgrund der Komplexität und Dynamik der Unternehmensumwelt
- Abgrenzung zwischen traditioneller und strategischer Kontrolle
- Elemente eines strategischen Kontrollsystems
- Funktionen und Entwicklungsstufen strategischer Frühaufklärungssysteme
- Die Bedeutung der Frühaufklärung in einem dynamischen und komplexen Umfeld
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Problematik der Unvollständigkeit strategischer Pläne und die daraus resultierende Notwendigkeit einer strategischen Kontrolle. Es werden die Ursachen für die Komplexität und Dynamik der Unternehmensumwelt, die zur Notwendigkeit einer Kontrolle führen, erläutert.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der strategischen Kontrolle und grenzt diese von der traditionellen Kontrolle ab. Es werden die Elemente eines strategischen Kontrollsystems, wie Prämissenkontrolle, Durchführungskontrolle und strategische Überwachung, vorgestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Konzept der strategischen Frühaufklärung und ihren Funktionen. Es werden die verschiedenen Entwicklungsstufen von Frühwarnsystemen, von Kennzahlensystemen bis hin zu Frühwarnsystemen auf Basis der Analyse schwacher Signale, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Strategische Kontrolle, strategische Frühaufklärung, Unternehmensumwelt, Komplexität, Dynamik, Prämissenkontrolle, Durchführungskontrolle, strategische Überwachung, Frühwarnsystem, schwache Signale, Anpassungsfähigkeit, Unternehmensplanung.
- Quote paper
- Manuel Koch (Author), 2004, Strategische Kontrolle und Strategische Frühaufklärung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/33360