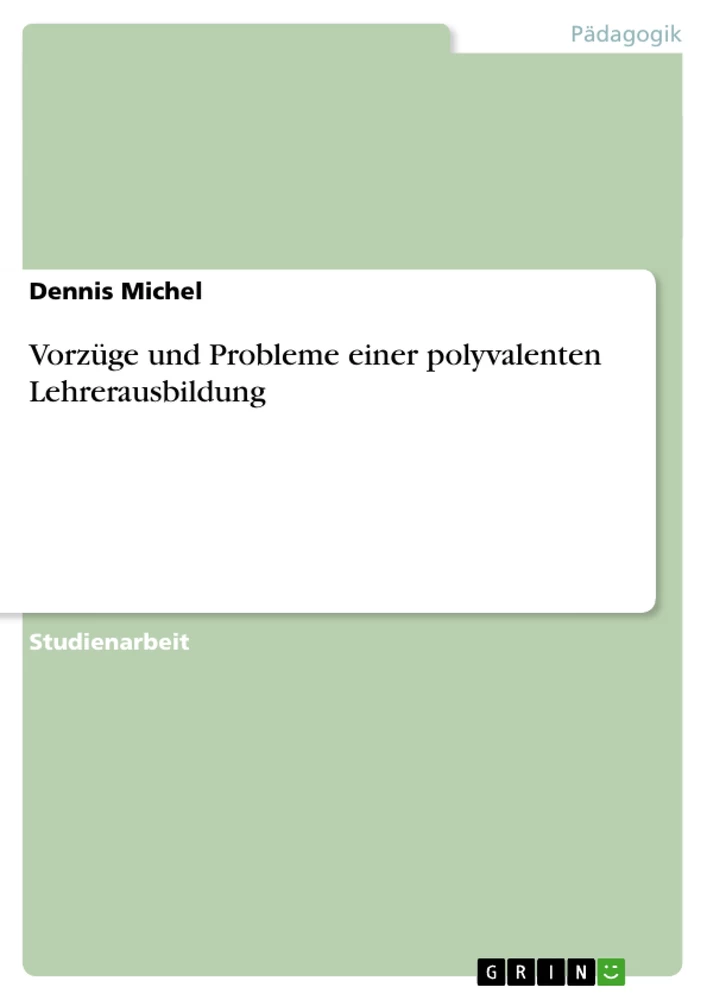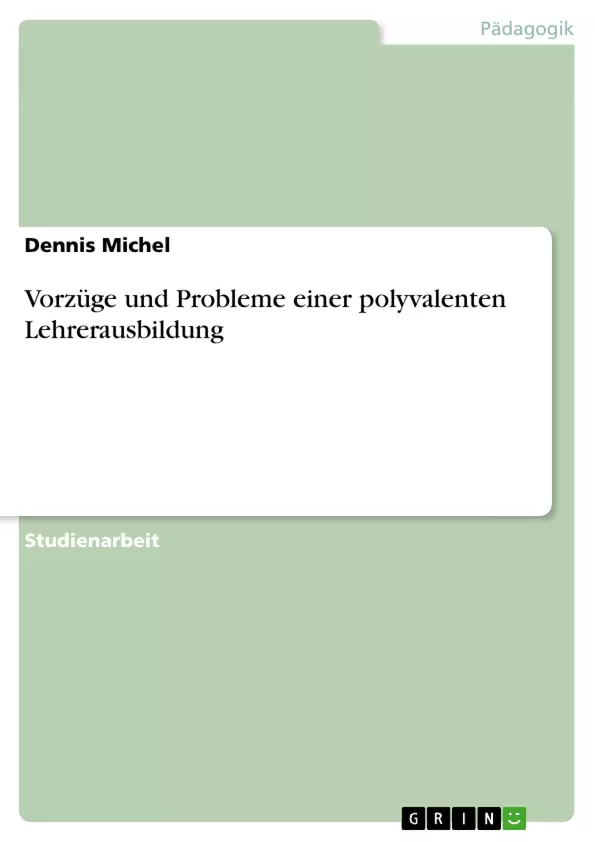Zur Zeit einer starken Arbeitslosigkeit wird immer mehr der Ruf nach Reformen und Veränderungen laut. So wird auch in der Lehrerbildung über systemkonforme Möglichkeiten nachgedacht, die dem Lehrer einen Einstieg in andere Berufssparten ermöglichen soll. War die Tätigkeit des Lehrers, dem Abschluss nach, nur für die Institution der Schule vorgesehen, soll er nun in Form von Polyvalenz in der Berufsausbildung, seiner bisherigen monovalenten Qualifikation zum Trotz, andere Branchen erschließen können. Diese Arbeit befasst sich nun gezielt mit den Problemen und Vorzügen einer solchen problemadäquaten, polyvalenten Lehrerbildung, welche ich versuchen werde anhand von praxisorientierten Modellen darzustellen. Aufgrund der vorgegebenen Begrenzung der Arbeit kann dies nur ein kleiner Teil des doch sehr komplexen und weitreichenden Themas sein.
Inhaltsverzeichnis
- Polyvalenz - eine Begriffsdefinition
- Polyvalenz in der Lehrerausbildung
- Einführung in das Thema
- Der Bachelor als Schritt in Richtung Polyvalenz der Bildungsreform
- positive Stimmen zum Bachelor
- negative Stimmen zum Bachelor
- Modell einer integrierten, professionalisierten und polyvalenten Lehrerausbildung nach J. Schützenmeister
- positive und negative Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vorzüge und Probleme einer polyvalenten Lehrerausbildung. Sie analysiert, wie die Reform der Lehrerbildung, insbesondere die Einführung des Bachelor-Systems, die Möglichkeiten für Lehrer eröffnet, auch außerhalb des Schulwesens tätig zu sein. Die Arbeit beleuchtet dabei sowohl positive als auch negative Aspekte dieser Entwicklung.
- Definition und Bedeutung von Polyvalenz in der Lehrerausbildung
- Der Bachelor als Instrument zur Förderung der Polyvalenz
- Vorteile und Nachteile einer polyvalenten Lehrerausbildung
- Modelle für eine integrierte und professionalisierte Lehrerausbildung
- Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt für Lehrer
Zusammenfassung der Kapitel
Polyvalenz - eine Begriffsdefinition: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Polyvalenz" im Kontext von Bildungsabschlüssen. Es beschreibt Polyvalenz als die Möglichkeit, einen Abschluss in verschiedenen Berufsfeldern einzusetzen, im Gegensatz zu monovalenten Abschlüssen, die nur auf ein spezifisches Berufsfeld ausgerichtet sind. Der Fokus liegt auf der Flexibilität und den breiteren Anwendungsmöglichkeiten eines polyvalenten Abschlusses.
Polyvalenz in der Lehrerausbildung: Dieses Kapitel spezialisiert die Definition von Polyvalenz auf die Lehrerausbildung. Es argumentiert, dass eine polyvalente Lehrerausbildung Lehrern die Möglichkeit geben sollte, auch außerhalb des Schulwesens beruflich tätig zu werden, was besonders in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit relevant ist. Der Abschnitt stellt den Übergang von einer monovalenten zu einer polyvalenten Qualifikation im Lehrberuf in den Mittelpunkt.
Einführung in das Thema: Die Einleitung skizziert den Kontext der Arbeit, der durch den Bedarf an Reformen im Bildungssystem und die steigende Arbeitslosigkeit geprägt ist. Die Arbeit befasst sich mit den Vor- und Nachteilen einer polyvalenten Lehrerbildung und kündigt die Darstellung praxisorientierter Modelle an. Aufgrund des begrenzten Umfangs wird eine umfassende Behandlung des komplexen Themas jedoch nicht angestrebt.
Der Bachelor als Schritt in Richtung Polyvalenz der Bildungsreform: Dieses Kapitel analysiert die Einführung des Bachelor-Systems im Kontext des Bologna-Prozesses und dessen Auswirkungen auf die Lehrerausbildung. Es diskutiert die Ziele des Bachelor-Systems, wie z.B. verkürzte Studienzeiten, stärkeren Praxisbezug und verbesserte internationale Vergleichbarkeit. Die Möglichkeit, durch die Wahl von Modulen den Studiengang flexibel zu gestalten und gegebenenfalls ohne Lehramtsabschluss zu beenden, wird als Aspekt der Polyvalenz hervorgehoben.
Modell einer integrierten, professionalisierten und polyvalenten Lehrerausbildung nach J. Schützenmeister: Dieser Abschnitt (welches Modell genau von J.Schützenmeister gemeint ist, wird leider nicht näher erläutert) widmet sich einem Modell, dass eine integrierte, professionalisierte und polyvalente Lehrerausbildung vorschlägt. Es ist zu erwarten, dass dieses Kapitel positive und negative Aspekte eines solchen Modells diskutiert und die Auswirkungen auf die Ausbildung der Lehrkräfte im Detail beleuchtet. Hier wird wohl kritisch auf Vor- und Nachteile solcher Modelle eingegangen.
Schlüsselwörter
Polyvalenz, Lehrerausbildung, Bachelor, Bologna-Prozess, monovalente Qualifikation, Arbeitsmarkt, Studienreform, Praxisbezug, Professionalisierung, Hochschulreform.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Polyvalente Lehrerausbildung
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile einer polyvalenten Lehrerausbildung, insbesondere im Kontext der Einführung des Bachelor-Systems und der damit verbundenen Reformen im Bildungssystem. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Ausbildung von Lehrkräften so gestaltet werden kann, dass sie auch außerhalb des Schulwesens beruflich tätig sein können.
Was versteht die Arbeit unter „Polyvalenz“?
Polyvalenz wird als die Möglichkeit definiert, einen Bildungsabschluss in verschiedenen Berufsfeldern einzusetzen, im Gegensatz zu monovalenten Abschlüssen, die nur auf ein spezifisches Berufsfeld ausgerichtet sind. Im Kontext der Lehrerausbildung bedeutet dies, dass Lehrkräfte auch außerhalb des Schulsystems arbeiten können.
Welche Rolle spielt der Bachelor in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Einführung des Bachelor-Systems im Rahmen des Bologna-Prozesses und seine Auswirkungen auf die Polyvalenz der Lehrerausbildung. Die Flexibilität des Bachelor-Systems, z.B. durch die Wahl von Modulen, wird als ein Aspekt der Polyvalenz hervorgehoben. Sowohl positive als auch negative Aspekte des Bachelor-Systems im Hinblick auf die Polyvalenz der Lehrerausbildung werden diskutiert.
Welche Modelle für eine polyvalente Lehrerausbildung werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet ein Modell einer integrierten, professionalisierten und polyvalenten Lehrerausbildung nach J. Schützenmeister (welches Modell genau gemeint ist, wird leider nicht näher erläutert). Es werden die Vor- und Nachteile dieses Modells diskutiert, jedoch ohne detaillierte Beschreibung des Modells selbst.
Welche weiteren Themen werden in der Arbeit behandelt?
Neben dem zentralen Thema der Polyvalenz in der Lehrerausbildung werden auch die Bedeutung der Polyvalenz im Kontext der Arbeitsmarktlage für Lehrer, die Auswirkungen der Studienreform und der Bologna-Prozess behandelt. Die Arbeit bietet eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und eine Definition der Schlüsselbegriffe.
Gibt es eine umfassende Behandlung des Themas?
Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit wird keine umfassende Behandlung des komplexen Themas angestrebt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der wichtigsten Aspekte der polyvalenten Lehrerausbildung.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Polyvalenz, Lehrerausbildung, Bachelor, Bologna-Prozess, monovalente Qualifikation, Arbeitsmarkt, Studienreform, Praxisbezug, Professionalisierung, und Hochschulreform.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Begriffsdefinition von Polyvalenz, Polyvalenz in der Lehrerausbildung, Einführung in das Thema, Der Bachelor als Schritt in Richtung Polyvalenz der Bildungsreform, Modell einer integrierten, professionalisierten und polyvalenten Lehrerausbildung nach J. Schützenmeister, und Fazit. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für alle Personen relevant, die sich mit der Lehrerausbildung, Studienreformen und dem Arbeitsmarkt für Lehrer beschäftigen. Sie richtet sich insbesondere an akademische Leser, die an einer strukturierten Analyse des Themas interessiert sind.
- Quote paper
- Dennis Michel (Author), 2004, Vorzüge und Probleme einer polyvalenten Lehrerausbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/32992