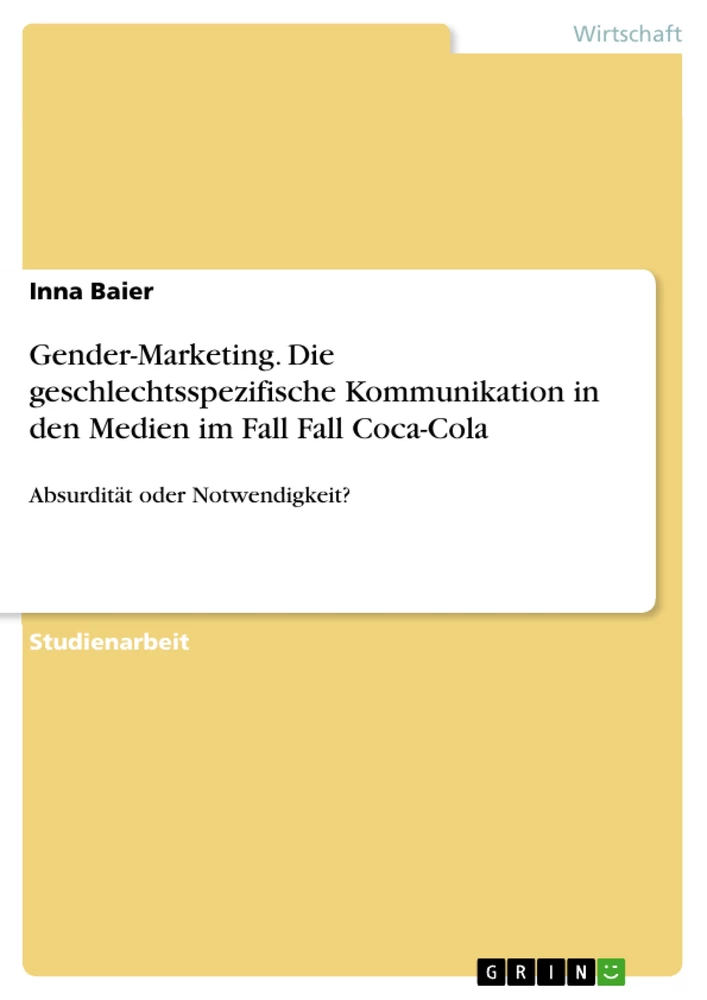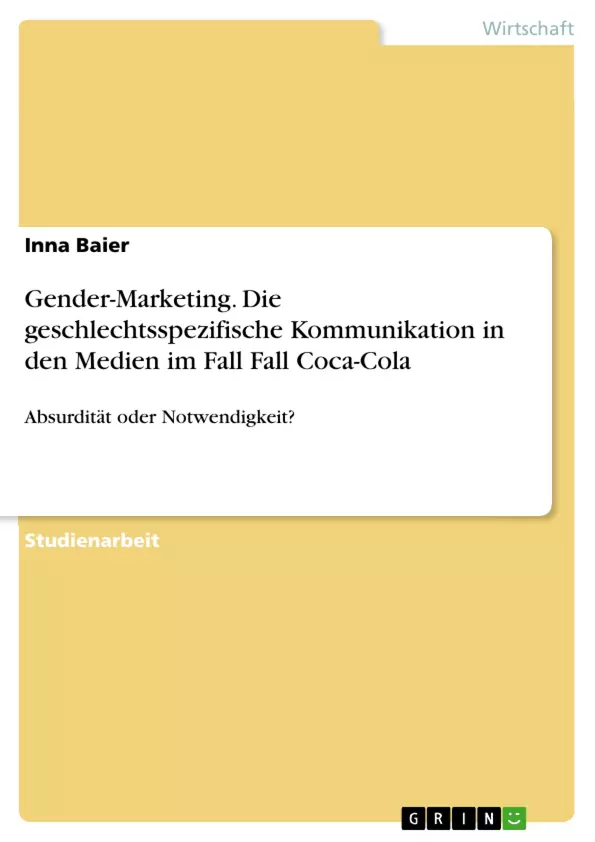Seit Anbeginn der Menschheit existieren zwei Subjekte die sich gleichzeitig so ähnlich aber auch so verschieden wie keine anderen sind, nämlich der Mann und die Frau. Jahrhunderte lang haben die großen Denker jeder Epoche die Art des Einzelnen sowie die Gegensätzlichkeit zu erforschen versucht, um somit Aufschlüsse über die Wesen dieser zu liefern. Dennoch sind die Differenzen bis zum heutigen Tage nicht komplett durchschaubar. Grade in der heutigen Zeit, in der sowohl die Frauenrolle, als auch die der Männer, nicht mehr mit dem traditionellen Bild übereinstimmen gewinnt die Thematik „Gender“ kontinuierlich an geschäftlicher sowie ökonomischer Relevanz.
Mit der Problematik des sozialen Geschlechts sowie dem Umgang dessen, beschäftigen sich zahlreiche wissenschaftlichen Disziplinen. Doch sind Mann und Frau so verschieden, dass es eine Genderorientierte Forschung bedarf? Und wie entstehen die Unterschiede der Geschlechter? Handelt es sich hierbei um fest verankerte Gegensätzlichkeit auf Basis unserer Gene oder entwickeln sich die Unterschiede im Laufe des Lebens mittels soziokultureller Einflüsse? Die entscheidende Fragestellung ist hierbei was eine Frau im biologischen Sinne zu einem weiblichen Wesen der Gesellschaftsnorm entsprechend ausmacht und in wie weit das Individuum sich bei der Konstruktion des eigenen Geschlechtes mittels der Umwelt determinieren lässt. Ist es notwendig auf Grund der Unterschiede auch innerhalb der externen Kommunikation z.B. seitens der Unternehmen eine artgerechte Anpassung zu betreiben?
Im Rahmen dieser Arbeit werde ich mich vor allem auf die geschlechtsspezifische Kommunikation sowie dessen Notwenigkeit fokussieren. Zunächst wird im zweiten Kapitel ein Überblick der Genderthematik vermittelt, hierbei wird sowohl eine genaue Definition des Begriffes „Gender“ geliefert, als auch im Zuge dessen die bedeutsamen Forschungsfelder der Geschlechterwissenschaft vorgestellt. Aufbauend darauf, werden im dritten Abschnitt die expliziten Kommunikationsunterschiede der Geschlechter analysiert. Hierbei werde ich mich auf die sprachwissenschaftlichen Theorien stützen und sie im näheren Detail erläutern. Anknüpfend daran wird anhand von der Disziplin Gender Marketing verdeutlich, wie die Unternehmen mit den Unterschieden von Mann und Frau umgehen und mittels kommunikativer Marketing Maßnahmen auf das einzelne Geschlecht gezielt einwirken. Abschließend werden anhand von ökonomischen Kennzahlen die Erfolge von Gender Communication gewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagendefinition
- Gender vs. Sexus
- Gender Studies und der Feminismus
- Theoretische Forschungsansätze
- Defizit-Modell
- Differenz-Theorie
- Doing Gender in den Medien
- Gender Marketing
- Gender Communication
- Praxisbeispiel Coca-Cola
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der geschlechtsspezifischen Kommunikation in den Medien und analysiert, ob diese eine Notwendigkeit oder eine Absurdität darstellt. Dabei werden grundlegende Definitionen von Gender und Sexus sowie wichtige Konzepte der Gender Studies und des Feminismus erläutert. Die Arbeit untersucht verschiedene theoretische Forschungsansätze, die die Unterschiede zwischen den Geschlechtern erklären, und beleuchtet die Praxis von Gender Marketing und Gender Communication in den Medien.
- Die Unterscheidung zwischen Gender und Sexus
- Die Rolle von Gender Studies und Feminismus im Verständnis von Geschlechterrollen
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Geschlechterunterschieden
- Die Anwendung von Gender Marketing und Gender Communication in den Medien
- Die Analyse eines Praxisbeispiels, Coca-Cola, in Bezug auf geschlechtsspezifische Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der geschlechtsspezifischen Kommunikation anhand eines Werbeslogans einer Schweizer Luxusmarke für Herrenuhren vor. Sie führt in die Thematik ein und beleuchtet die Bedeutung des Konzepts „Gender“ in der heutigen Zeit.
Das Kapitel „Grundlagendefinition“ erläutert die Unterscheidung zwischen Gender und Sexus und beleuchtet die Rolle von Gender Studies und Feminismus im Verständnis von Geschlechterrollen. Es liefert eine Grundlage für die weitere Analyse.
Das Kapitel „Theoretische Forschungsansätze“ stellt verschiedene Theorien vor, die die Unterschiede zwischen den Geschlechtern erklären. Es beleuchtet das Defizit-Modell und die Differenz-Theorie und untersucht die jeweiligen Stärken und Schwächen.
Das Kapitel „Doing Gender in den Medien“ analysiert die Praxis von Gender Marketing und Gender Communication in den Medien. Es untersucht die Strategien, die Unternehmen einsetzen, um ihre Produkte an bestimmte Geschlechtergruppen zu vermarkten.
Das Kapitel „Praxisbeispiel Coca-Cola“ analysiert die Werbestrategien von Coca-Cola in Bezug auf geschlechtsspezifische Kommunikation. Es untersucht die Verwendung von Gender-Stereotypen in den Werbekampagnen des Unternehmens.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Gender, Sexus, Gender Studies, Feminismus, geschlechtsspezifische Kommunikation, Gender Marketing, Gender Communication, Medien, Werbung, Coca-Cola, Stereotypen, Geschlechterrollen.
- Arbeit zitieren
- Inna Baier (Autor:in), 2016, Gender-Marketing. Die geschlechtsspezifische Kommunikation in den Medien im Fall Fall Coca-Cola, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/323986