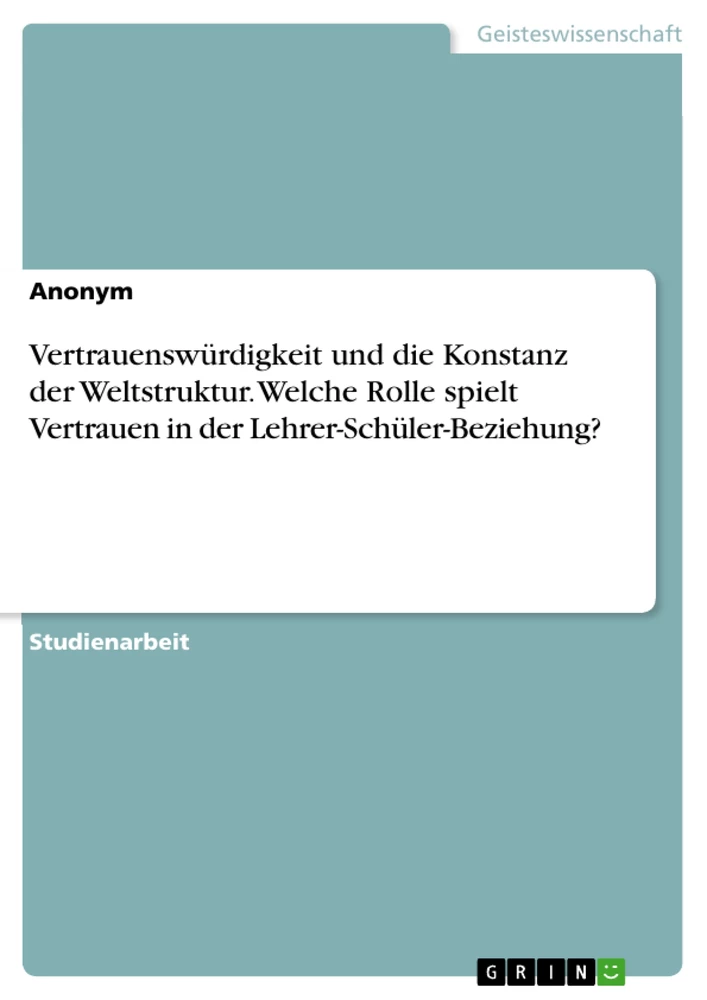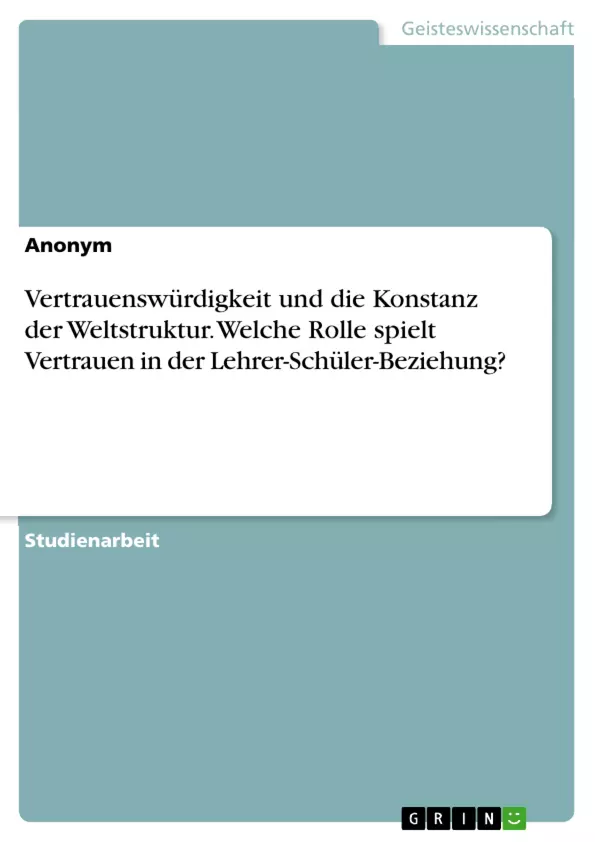Der Begriff des Vertrauens wird in der heutigen Zeit häufig genutzt. In vielen Zusammenhängen ist von Vertrauen die Rede und nimmt daher eine wichtige Position im menschlichen Dasein ein. „Men live upon trust“, aus diesem Zitat von John Locke geht hervor, dass Vertrauen eine wichtige Rolle im Leben der Menschen spielt. Für die Beantwortung der Frage, wie es möglich ist, dass die Menschen miteinander leben können und so zu zivilisierten Menschen werden, spielt Vertrauen eine große Rolle. Mit dieser Thematik setzte sich schon Hobbes auseinander. Diese Problemstellung wird häufiger auch als „Hobbesches Problem der Ordnung“ bezeichnet. Sicherlich kennt auch jeder Mensch „Vertrauen“ aus dem eigenen Leben. Es wird beispielsweise darauf vertraut, dass jemand etwas tut, getan hat oder tun wird. Dieses Vertrauen baut sich auf bestimmten Erwartungen auf.
Amelang, Gold und Külbel stellten 1984 fest, dass der Aufbau und Verlauf der Beziehungen zwischen einzelnen Staaten, zwischen Regierungen und Regierten, zwischen Minoritäten und Majoritäten, zwischen Kunden und Verkäufern, Patienten und Therapeuten, Eltern und Kindern, Anwälten und Klienten in einem entscheidenden Ausmaß von dem Vertrauen determiniert wird, welches die beteiligten Interaktionspartner einbringen, so dass ein Verlust des Vertrauens zu Beeinträchtigungen der Beziehungen und damit zu Störungen der sozialen Ordnung führt. Dabei wird deutlich, welche große Rolle Vertrauen in unserer Gesellschaft zukommt.
Doch was bedeutet „Vertrauen“? Welche Rolle spielt es in menschlichen Beziehungen und insbesondere in der Lehrer-Schüler-Beziehung? Diese Fragen sollen mit der vorliegenden Arbeit geklärt werden.
Im ersten Teil der Arbeit wird der Begriff des „Vertrauen“ erläutert, um zu klären, von welchem Vertrauensbegriff in der vorliegenden Arbeit ausgegangen wird. Weiter soll gezeigt werden, welche Rolle Zeichen im Vertrauen spielen. Nach dem theoretischen Hintergrund und soll dieser auf die Praxis in Form der Lehrer-Schüler-Beziehung angewandt werden. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff „Vertrauen“
- Vertrauenswürdigkeit, Zweifel und Wagnis
- Vertrauenswürdigkeit
- Zweifelsfreiheit
- Vertrauen als Wagnis
- Worauf lässt sich vertrauen?
- Konstanz der Weltstruktur
- Lehrer-Schüler-Beziehung und Vertrauen
- Vertrauenswürdigkeit zwischen Lehrer und Schüler
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Begriff des Vertrauens in der Lehrer-Schüler-Beziehung. Sie befasst sich mit der Frage, wie Vertrauen in dieser Beziehung entsteht, welche Faktoren es beeinflussen und welche Rolle es für das Gelingen des Unterrichts spielt.
- Der Begriff „Vertrauen“ und seine Bedeutung in zwischenmenschlichen Beziehungen
- Die Faktoren, die die Vertrauenswürdigkeit zwischen Lehrer und Schüler beeinflussen
- Die Rolle des Vertrauens für die Gestaltung des Unterrichts
- Die Herausforderungen, die mit dem Aufbau von Vertrauen in der Lehrer-Schüler-Beziehung verbunden sind
- Möglichkeiten, das Vertrauen zwischen Lehrer und Schüler zu fördern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Vertrauens ein und stellt die Relevanz des Themas für die Lehrer-Schüler-Beziehung dar. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff des Vertrauens und stellt verschiedene Definitionen und Perspektiven auf den Begriff dar. Das dritte Kapitel untersucht die Faktoren, die die Vertrauenswürdigkeit zwischen Menschen beeinflussen, insbesondere die Rolle von Zweifel und Wagnis. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, worauf sich Vertrauen gründen kann, wobei die Konstanz der Weltstruktur als ein wichtiger Faktor hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Vertrauen, Lehrer-Schüler-Beziehung, Vertrauenswürdigkeit, Zweifel, Wagnis, Konstanz der Weltstruktur, Unterrichtsgestaltung, Herausforderungen, Förderung
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Vertrauenswürdigkeit und die Konstanz der Weltstruktur. Welche Rolle spielt Vertrauen in der Lehrer-Schüler-Beziehung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/322578