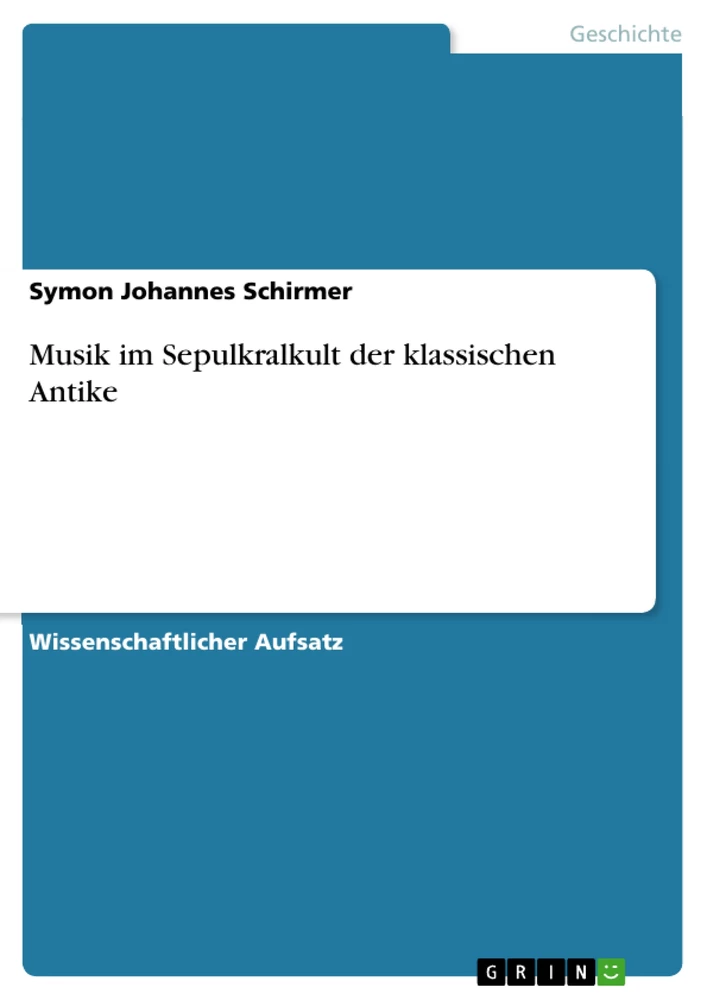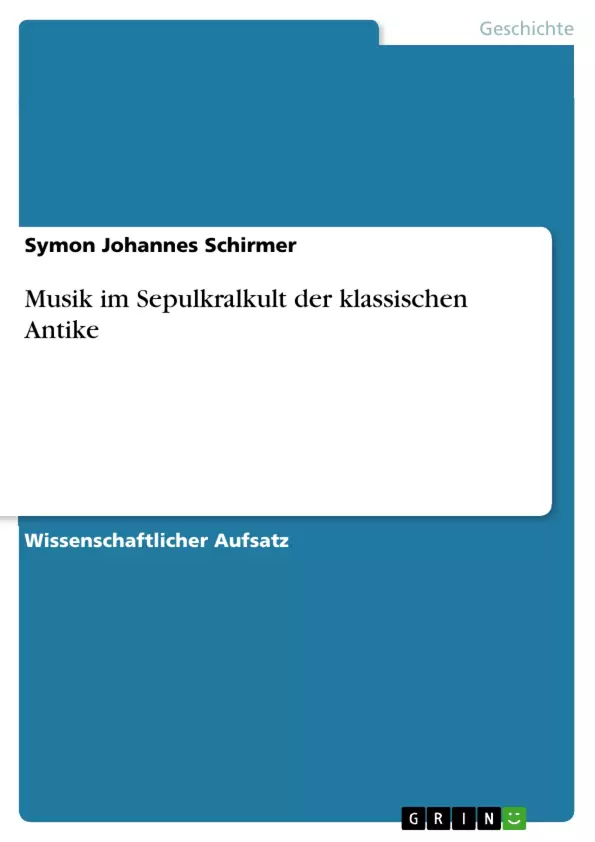Die vorliegende Arbeit behandelt den Aspekt der Musik im Sepulkralkult der griechisch-römischen Antike. Da eine exakte Abgrenzung zwischen Lautäußerungen, vor allem der Wehklage und begleitender Musik darin oftmals nur schwer möglich ist und mir auch nicht sinnvoll erschiene, sollen im Folgenden beide Aspekte untersucht und differenziert dargestellt werden. Die Überlieferung dieser mit einander her gehenden Phänomene will ich zunächst in der griechischen Antike untersuchen, bevor eine Analyse derselben im römischen Ritus folgt.
Dabei werde ich jeweils den Ablauf der Kulthandlungen darlegen und durch für das Thema dieser Arbeit relevante Darstellungen illustrieren. Zusammen mit Quellen schriftlicher Überlieferung bilden sie auch die wichtigste Grundlage meiner eigenen Beschäftigung, bzw. zur Erstellung der vorliegenden Arbeit. Hilfreich waren mir daneben auch Publikationen zu weiteren Aspekten des Bestattungskults, die mir die Kontextualisierung der dargestellten und beschriebenen Kulthandlungen ermöglichten.
Auch hier liegt der Fokus meist im römischen Kult, während der griechische auch aufgrund eines Mangels an Darstellungen und Schriftquellen weniger im Zentrum steht. Gleich ist beiden, Griechen wie Römern ein tradierter und daher streng vorgegebener Ablauf zur Beisetzung Verstorbener, der sich in jeweils zwei wesentliche Etappen gliedert.
In beiden Kulturen sind dies zunächst eine Aufbahrung des Toten und schließlich die Überführung zum Begräbnisort. Bedeutung hat der Ritus nicht ausschließlich für den Toten selbst, der so vom Diesseits in Jenseits geleitet werden soll; auch für die Hinterbliebenen sind die Kulthandlungen geradezu notwendig. Schließlich sind die Mitglieder der Famiglia mit dem Ableben ihres Angehörigen rituell unrein, bzw. ‚vom Tod‘ befleckt. Im Altgriechischen gibt es hierzu das Wort Miasma, das im direkten wie auch im übertragenen Sinn eine Verunreinigung meint. Um dies abzuschütteln ist nun ein bestimmter Ablauf vorgesehen, in dem Gesang, Lautäußerungen verschiedener Art und instrumentale Untermalung eine bedeutende Rolle einnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Musik im griechischen Sepulkralkult
- II.I Prothesis
- II.II Ekphora
- III Musik im römischen Sepulkralkult
- III.I Collocatio
- III.II Pompa funebris
- III.III Grablege/Kremation
- IV Summa
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Musik im griechischen und römischen Sepulkralkult der Antike. Der Fokus liegt auf der Differenzierung zwischen Lautäußerungen (Wehklage) und instrumentaler Musik innerhalb der Bestattungsrituale. Die Analyse umfasst sowohl die griechische als auch die römische Kultur, wobei die Entwicklungen und Unterschiede in den jeweiligen Riten beleuchtet werden.
- Die musikalische Gestaltung der griechischen Prothesis und Ekphora.
- Der Vergleich der griechischen und römischen Bestattungsrituale.
- Die Rolle von Klageliedern (Threnoi und Nenien) im Sepulkralkult.
- Der Einfluss von sozialem Status auf die Ausgestaltung der Bestattungsrituale.
- Die ikonographischen und schriftlichen Quellen zur Rekonstruktion der musikalischen Praxis.
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Arbeit untersucht die Rolle der Musik im Sepulkralkult der griechisch-römischen Antike, wobei die oft schwer trennbare Wehklage von der Musik begleitet betrachtet wird. Der Fokus liegt auf der Analyse der griechischen und römischen Riten, deren Ablauf anhand schriftlicher und bildlicher Quellen rekonstruiert wird. Die Arbeit stützt sich auf diverse Publikationen zum Bestattungskult, insbesondere die Dissertation von Anna Schreiber-Schermutzki über Trauerdarstellungen auf römischen Grabmale, um ein umfassendes Bild zu zeichnen, da das Thema in der Literatur oft nur am Rande behandelt wird. Die Arbeit beleuchtet den streng vorgegebenen Ablauf der Bestattungsrituale in beiden Kulturen, bestehend aus der Aufbahrung des Toten (Prothesis/Collocatio) und der Überführung zum Begräbnisort (Ekphora/Pompa funebris), welche sowohl für den Verstorbenen als auch die rituell unreinen Hinterbliebenen notwendig waren.
II Musik im griechischen Sepulkralkult: Dieses Kapitel gliedert sich in die Prothesis und die Ekphora. Die Prothesis, die Aufbahrung des Toten, beginnt mit der Waschung und Salbung. Geometrische Keramik und homerische Epen liefern erste Hinweise auf diesen Ritus, der sich durch Trauergesten der Frauen (Haareraufen, Brustschlagen) und Klagen auszeichnete. Im Gegensatz dazu traten Männer eher als Musiker in Erscheinung, wobei eine instrumentale Begleitung der Klagen aber kaum belegt ist. Die Ekphora, die Überführung zum Bestattungsort, zeigt in Darstellungen oft eine instrumentale Begleitung (Aulosspiel) von Gesang und Klagen. Das Seikilos-Lied, ein Threnos auf einer Grabstele, liefert Einblicke in die Art der Klagelieder, die möglicherweise auch am Grab gesungen wurden, um dem Toten zu ehren und die Memoria aufrechtzuerhalten. Eine klare Trennung zwischen Klagen und musikalischer Begleitung ist jedoch nicht immer möglich.
III Musik im römischen Sepulkralkult: Dieses Kapitel analysiert die Collocatio, Pompa funebris und die Grablege/Kremation. Die Collocatio, die römische Entsprechung der Prothesis, zeigt eine deutliche griechisch-hellenistische Prägung, beinhaltet aber auch eigenständige Entwicklungen. Das Haterierrelief veranschaulicht die Totenklage mit Klagegesten, Gesang und Tibiaspiel. Gewerbsmäßige Klagefrauen (Praeficae) übernehmen einen wichtigen Teil des Rituals, welches durch übertriebene Gesten und Laute publikumswirksam inszeniert wurde. Die Pompa funebris, die Überführung, wird anhand des Amiternum-Reliefs dargestellt, welches eine vielfigurige Prozession mit Musikanten (Tibia, Cornu, Tuba) und Klagefrauen zeigt. Der Zug war eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung, die den Status des Verstorbenen und seiner Familie hervorhob. Cicero und das Zwölftafelgesetz liefern weitere Informationen über die musikalische Begleitung und die Lautstärke der Klage. Über die Grablege/Kremation ist weniger bekannt; die Aeneis bietet eine Beschreibung eines von Musik und Klagen begleiteten Rituals um die Kremation.
Schlüsselwörter
Sepulkralkult, Musik im antiken Griechenland, Musik im antiken Rom, Prothesis, Ekphora, Collocatio, Pompa funebris, Grablege, Kremation, Threnoi, Nenien, Praeficae, Trauergesten, Ikonographie, Schriftquellen, Römische und Griechische Kultur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Musik im griechischen und römischen Sepulkralkult
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Musik im griechischen und römischen Sepulkralkult der Antike. Der Fokus liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen vokalen Äußerungen (Wehklagen) und instrumentaler Musik innerhalb der Bestattungsrituale beider Kulturen und den Unterschieden in den jeweiligen Riten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Musik im griechischen Sepulkralkult, Musik im römischen Sepulkralkult und Zusammenfassung. Das Kapitel über den griechischen Sepulkralkult behandelt die Prothesis (Aufbahrung) und die Ekphora (Überführung). Das Kapitel über den römischen Sepulkralkult analysiert die Collocatio (römische Entsprechung der Prothesis), die Pompa funebris (Überführung) und die Grablege/Kremation.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf diverse Publikationen zum Bestattungskult, insbesondere die Dissertation von Anna Schreiber-Schermutzki über Trauerdarstellungen auf römischen Grabmale. Zusätzlich werden geometrische Keramik, homerische Epen, das Seikilos-Lied, das Haterierrelief, das Amiternum-Relief, die Aeneis von Virgil sowie Schriften von Cicero und das Zwölftafelgesetz herangezogen.
Welche Aspekte der Musik im Sepulkralkult werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die musikalische Gestaltung der griechischen Prothesis und Ekphora, vergleicht die griechischen und römischen Bestattungsrituale, untersucht die Rolle von Klageliedern (Threnoi und Nenien), beleuchtet den Einfluss des sozialen Status auf die Rituale und rekonstruiert die musikalische Praxis anhand ikonographischer und schriftlicher Quellen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der oft schwer trennbaren Verbindung von Wehklage und Musik.
Welche Rolle spielen Klagefrauen (Praeficae)?
Im römischen Sepulkralkult spielten gewerbsmäßige Klagefrauen (Praeficae) eine wichtige Rolle. Sie inszenierten die Totenklage mit übertriebenen Gesten und Lauten, um eine publikumswirksame Wirkung zu erzielen.
Wie wird die instrumentale Musik im Sepulkralkult dargestellt?
Instrumentale Musik wird in verschiedenen Quellen dargestellt, darunter das Aulosspiel in der griechischen Ekphora und die Verwendung von Tibia, Cornu und Tuba in der römischen Pompa funebris. Die Quellenlage variiert jedoch, und eine eindeutige Trennung zwischen vokalen und instrumentalen Elementen ist nicht immer möglich.
Welche Bedeutung haben die schriftlichen Quellen?
Schriftliche Quellen wie die Schriften von Cicero und das Zwölftafelgesetz liefern Informationen über die musikalische Begleitung und die Lautstärke der Klage im römischen Sepulkralkult. Homerische Epen und das Seikilos-Lied bieten Einblicke in die Art der Klagelieder im griechischen Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Sepulkralkult, Musik im antiken Griechenland, Musik im antiken Rom, Prothesis, Ekphora, Collocatio, Pompa funebris, Grablege, Kremation, Threnoi, Nenien, Praeficae, Trauergesten, Ikonographie, Schriftquellen, Römische und Griechische Kultur.
- Arbeit zitieren
- Symon Johannes Schirmer (Autor:in), 2015, Musik im Sepulkralkult der klassischen Antike, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/322328