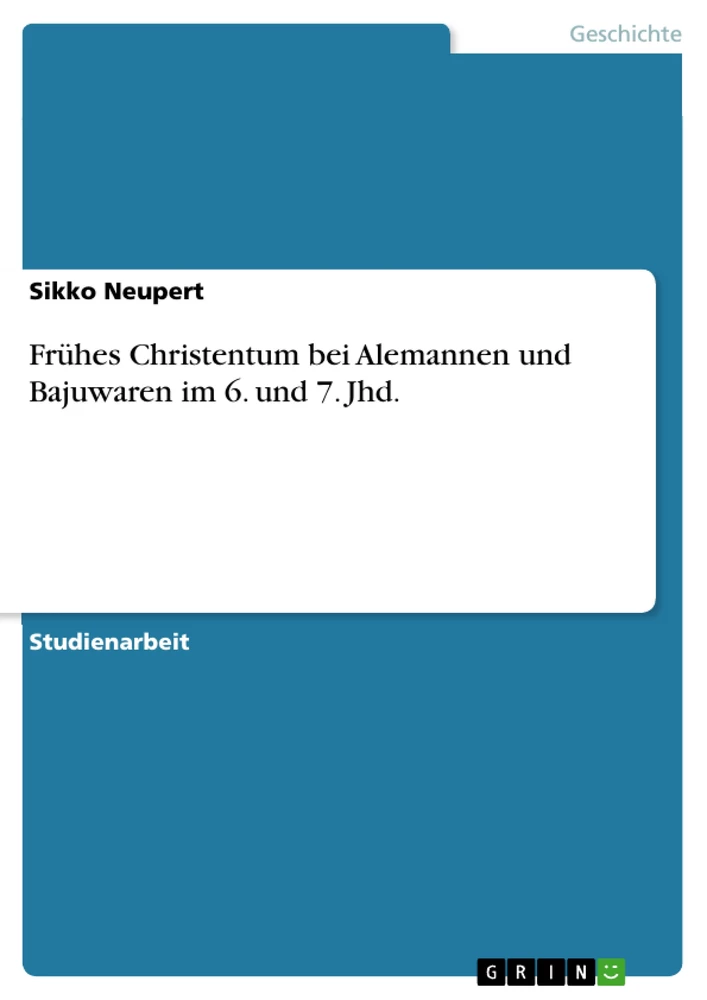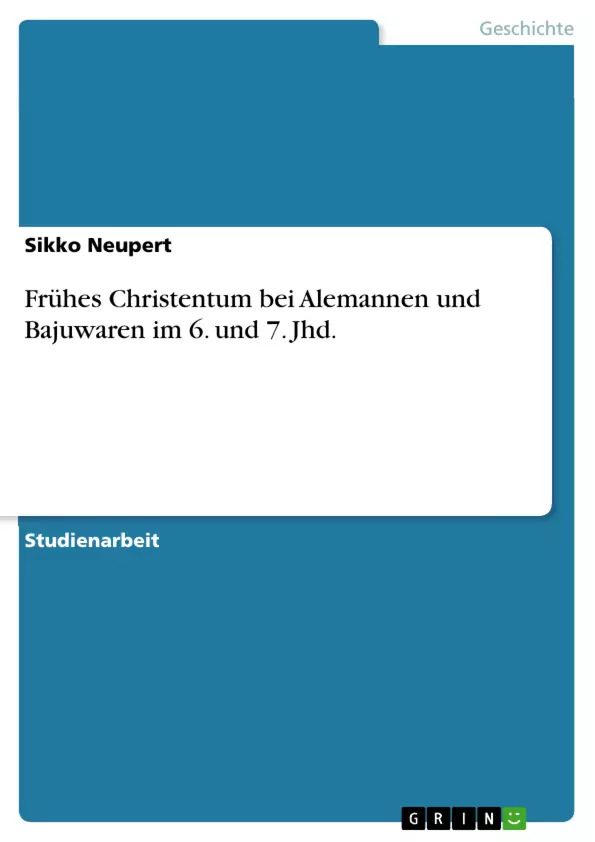Eine Arbeit über die Aussagemöglichkeit der Archäologie zu einem bestimmten Thema, zumal eine, die in ihrem Umfang begrenzt ist, kann nicht alle historischen und archäologischen Erkenntnisse über die entsprechenden Subjekte (hier also die Alemannen und Bajuwaren im 6. und 7. Jh.) erfassen und darstellen. Um eine befriedigende Tiefe zu erreichen muss sie sich deshalb auf einige Beispiele konzentrieren und immer wieder die Frage stellen, inwieweit sich aufgrund des Beispiels eine Aussage treffen lässt über den Grad der Christianisierung, damit über das intrinsische und von außen immer unsichtbare christliche Bekenntnis der entsprechenden Person und der Gesellschaft in der sie lebte. Dass dieses interpretierte Bekenntnis dem entspricht, was wir heute, rund 1500 Jahre später unter christlichem Bekenntnis verstehen, mehr noch, dass wir unser heutiges Verständnis als Messlatte verwenden, um zwischen „noch-heidnisch“ und „schon-christlich“ zu trennen, ist gewagt, aber wohl unumgänglich. Anders als die Geschichtswissenschaft konzentriert sich die Vor- und Frühgeschichte dabei auf Bilder und Symbole, auf „handfeste“ Überreste der damaligen Zeit und trifft sie damit vielleicht sogar besser - diese (fast) schriftlose Zeit, in der eben Bilder und Symbole eine so bedeutende Rolle spielten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stand der Forschung
- Spätantike Traditionen
- Geschichtliche Einordnung
- Archäologische Spuren
- Spätantike Missionszentren oder christliche Minderheiten?
- Fazit
- Schriftquellen
- Columban-Vita
- Gallus-Vita
- Archäologische Zeugnisse
- Kirchbauten
- Aussage über das christliche Bekenntnis der Erbauer
- Aussage über „Adelsschicht“ im Frankenreich
- Fränkischer Einfluss
- Beispiele für Kirchbauten
- Goldblattkreuze
- Christliche Symbolik auf Trachtbestandteilen
- Christlich interpretierbare Symbolik
- Schmuck
- Amulettkapseln
- Kirchbauten
- Synkretismus
- Heidnische Beigabentradition
- Heidnische und christliche Trachtbeigaben
- Heidnische und christliche Symbolik auf einem Fund
- Ausblick/ Ergebnis
- Das Ende der Reihengräberzeit
- Bonifatius
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit archäologische Funde aus der Zeit der Alamannen und Bajuwaren im 6. und 7. Jahrhundert Aufschluss über die Verbreitung und Ausprägung des frühen Christentums in diesen Gebieten geben können. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob sich anhand archäologischer Zeugnisse das christliche Bekenntnis der damaligen Bevölkerung rekonstruieren lässt und in welcher Beziehung diese zum heidnischen Glauben stand.
- Die Rolle der Archäologie in der Erforschung des frühen Christentums
- Die Bedeutung von spätantiken Traditionen für die Christianisierung der Alamannen und Bajuwaren
- Die Analyse archäologischer Funde als Indiz für christliches Bekenntnis
- Die Bedeutung von Synkretismus im frühen Christentum
- Die Grenzen und Möglichkeiten der archäologischen Interpretation im Kontext der Religionsgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Zielsetzung und den methodischen Ansatz der Arbeit. Sie legt dar, dass die Arbeit sich auf ausgewählte Beispiele konzentriert und die Frage stellt, inwieweit sich aus diesen Aussagen über den Grad der Christianisierung ableiten lassen.
Im zweiten Kapitel wird der Stand der Forschung zur Christianisierung der Alamannen und Bajuwaren im 6. und 7. Jahrhundert dargestellt. Es wird auf die Bedeutung archäologischer Quellen im Kontext spärlicher schriftlicher Überlieferung hingewiesen und die wissenschaftlichen Debatten zur Interpretation der Funde skizziert.
Kapitel 3 befasst sich mit den spätantiken Traditionen. Die geschichtliche Einordnung beleuchtet die Ausbreitung des Christentums im römischen Reich und die Entstehung christlicher Zentren in den germanischen Provinzen. Es wird die Rolle des Afra-Kultes in Augsburg erwähnt und die Situation nach der Konstantinischen Wende sowie die Expansion der Alamannen in ehemals römische Gebiete beschrieben. Im Abschnitt 3.2 werden archäologische Spuren der spätantiken christlichen Tradition, wie Grabsteine, Brotstempel, Taubenfiguren und Kirchenbauten, vorgestellt. Es wird hervorgehoben, dass diese Spuren vorwiegend in den romanisierten Gebieten zu finden sind und eine christlich geprägte Landbevölkerung ausgeschlossen werden kann.
Kapitel 4 behandelt schriftliche Quellen, insbesondere die Columban-Vita und die Gallus-Vita.
Kapitel 5 analysiert archäologische Zeugnisse wie Kirchbauten, Goldblattkreuze, christliche Symbolik auf Trachtbestandteilen und Amulettkapseln.
In Kapitel 6 wird der Synkretismus zwischen heidnischen und christlichen Traditionen untersucht.
Schlüsselwörter
Alamannen, Bajuwaren, Frühes Christentum, Archäologie, Religionsgeschichte, Spätantike Traditionen, Synkretismus, Kirchbauten, Goldblattkreuze, Christliche Symbolik, Amulettkapseln.
- Quote paper
- Sikko Neupert (Author), 2004, Frühes Christentum bei Alemannen und Bajuwaren im 6. und 7. Jhd., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/32198