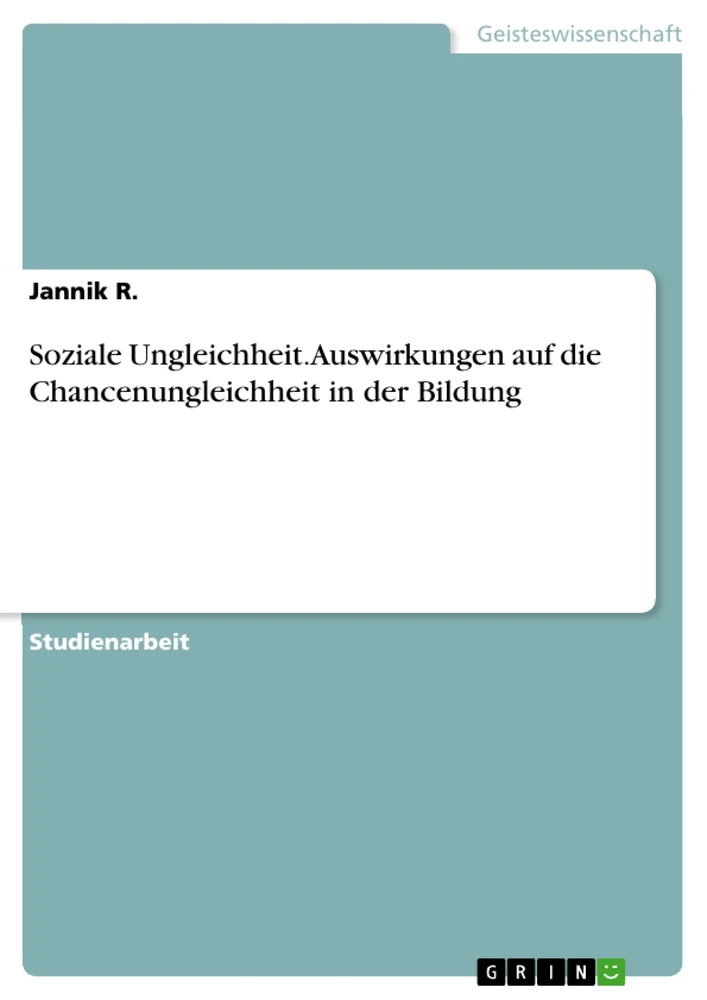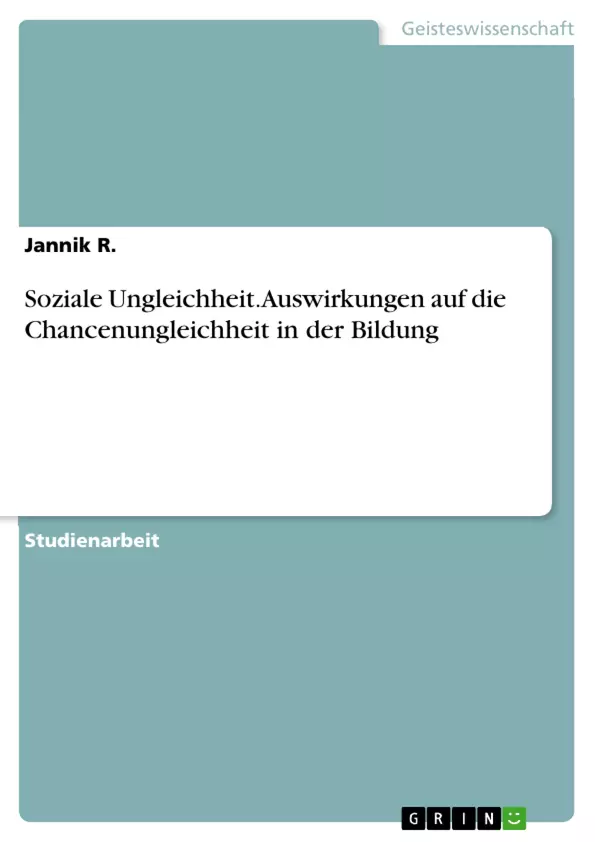Wirkt sich soziale Ungleichheit auf die Bildungschancen aus? Diese soziale Ungleichheit soll in der Arbeit definiert und genauer beleuchtet werden, orientiert an Schimank und Hradil. Im weiteren Verlauf wird dann die Bildungsungleichheit in Deutschland thematisiert. Drei Determinanten sozialer Ungleichheit werden mit den Chancen im Bildungssystem in Verbindung gesetzt. Es geht um verschiedenen Chancen im Bildungssystem aufgrund von verschiedenen sozialen Schichten, dem Migrationshintergrund und dem Geschlecht.
Hier werden Forschungsergebnisse und aktuelle Befunde präsentiert und auch die Ursachen für resultierende Chancenungleichheit in der Bildung angesprochen. Der letzte Teil der Arbeit ist dann ein zusammenfassendes Fazit, welches die Frage beantwortet, ob sich soziale Ungleichheit auf die Bildungschancen auswirkt. Abschließend wird noch die Wichtigkeit von Bildung und gleichen Bildungschancen herausgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Soziale Ungleichheit.
- Entstehung von sozialer Ungleichheit.
- Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf die Lebenschancen
- Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf die Bildungschancen....
- Die Soziale Herkunft als Grund für Bildungsungleichheit.
- Der Migrationshintergrund als Grund für Bildungsungleichheit.
- Das Geschlecht als Grund für Bildungsungleichheit.
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit sozialen Ungleichheiten und ihren Auswirkungen. Ziel ist es, die Entstehung und verschiedene Erscheinungsformen von sozialer Ungleichheit zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf Bildungschancen. Die Arbeit konzentriert sich auf Deutschland und analysiert die Rolle von sozialer Herkunft, Migrationshintergrund und Geschlecht als Determinanten der Bildungsungleichheit.
- Definition und Charakteristika von sozialer Ungleichheit.
- Analyse der Determinanten von Bildungsungleichheit (soziale Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht).
- Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Bildungschancen.
- Relevanz von Bildung und gleichen Bildungschancen für die Gesellschaft.
- Aktueller Forschungsstand und empirische Befunde zur Bildungsungleichheit.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Ungleichheit ein und erläutert den Fokus der Arbeit auf Bildungschancen. Sie beschreibt den Bezug zur Soziologie und den aktuellen Forschungsstand.
2. Soziale Ungleichheit
Dieses Kapitel behandelt die Definition von sozialer Ungleichheit, wobei die Ansätze von Schimank und Hradil im Mittelpunkt stehen. Es werden unterschiedliche Ungleichheitsdimensionen wie Bedürfnisbefriedigung und Einflusspotenziale sowie konkrete Ungleichheitsaspekte wie Geldbesitz, Bildung, soziales Kapital, Geschlecht, Ethnie und soziale Herkunft vorgestellt.
3. Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf die Lebenschancen
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich den Auswirkungen von sozialer Ungleichheit auf die Lebenschancen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Bildungschancen und den Einflussfaktoren wie sozialer Herkunft, Migrationshintergrund und Geschlecht. Es werden Forschungsergebnisse und aktuelle Befunde zu Chancenungleichheit im Bildungssystem präsentiert.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, Determinanten, Bildungschancen, Soziale Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht, Chancenungleichheit, Bildungssystem, Deutschland, Forschungsergebnisse, empirische Befunde.
- Arbeit zitieren
- Jannik R. (Autor:in), 2014, Soziale Ungleichheit. Auswirkungen auf die Chancenungleichheit in der Bildung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/320961