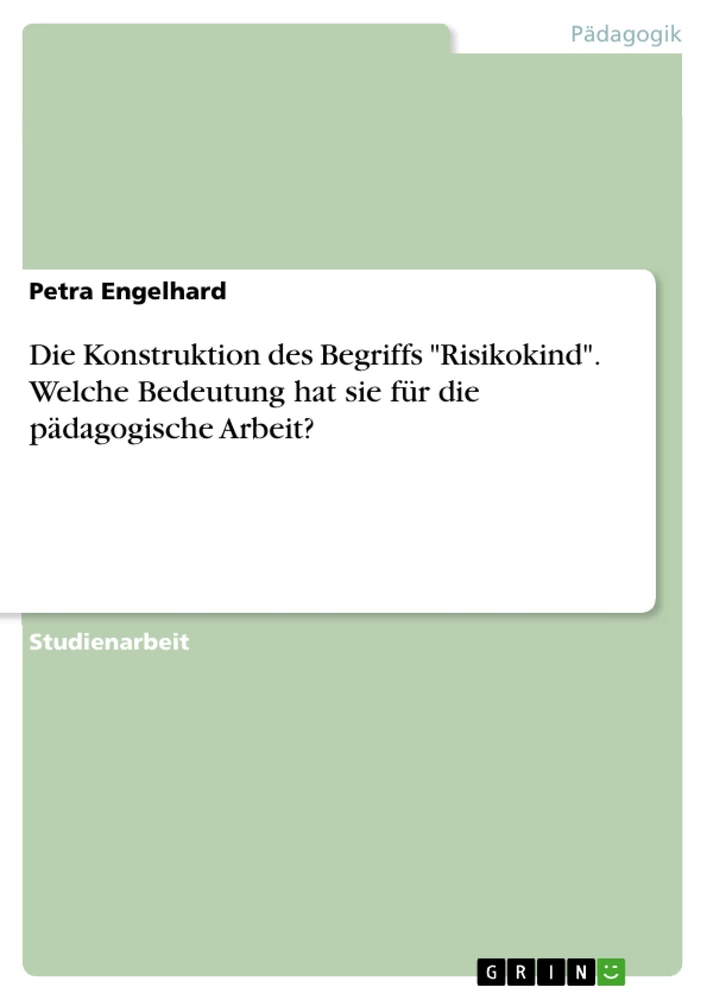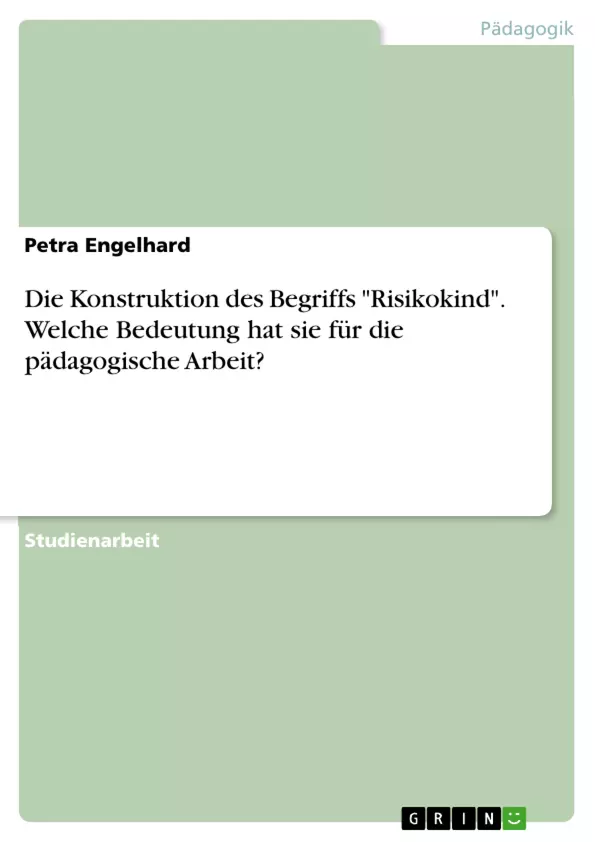In dieser Ausführung möchte ich meinem Anliegen folgen, Konstruktionen von Kindern zu beleuchten und darzulegen, welchen Kindern ein gewisses Risiko zugeschrieben wird. Wie diese Kindheitskonstruktionen in politischen Feldern hergestellt und verwendet werden, soll ebenso nachgegangen werden, wie der Bedeutung für die pädagogische Arbeit.
Einführend soll ein kurzer Einblick zu dem Thema von Risikokindern gegeben werden, in dem aufgezeigt wird, wer sich mit welchem Ziel mit Risikofaktoren auseinandersetzt. Wem fallen welche Zuschreibungen zu, um als ein Risiko zu gelten? Im nächsten Schritt soll sich mit dem Konstrukt von Kindern/ Kindheit beschäftigt werden, um aufzuzeigen, wie und unter welchen Einflüssen der Begriff des Kindes konstruiert wird, beziehungsweise welche Zuschreibungen dieser jeweils erhält.
Darauf folgend liegt der Fokus auf Risikokinder- Konstruktionen aus dem politischen Feld. Hierbei wird das Augenmerk auf den Umsetzungen liegen, die durch politische Felder geschaffen werden. Darauffolgend möchte ich mich den Ausführungen und um mögliche Muster innerhalb der Debatte zu Risikokonstruktionen annähern. Im Anschluss soll der Frage nach der Bedeutung von Risikokonstruktionen von Kindern für die pädagogische Arbeit nachgegangen werden. Mit einer Schlussbetrachtung wird die Ausarbeitung schließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Thematik der Risikolagen von Kindern und Kindheit
- Konstruktionen von Kindheit
- Konstruktionen von Risiko-Kindheit aus politischer Sicht
- Regulation der Bedingungen von Kindheit durch Gesetzgebung
- Veranschaulichung von Mustern in der Diskussion um Risikokonstruktionen
- Funktionen von Risikokonstruktionen
- Die Bedeutung von Risikokonstruktionen für die pädagogische Arbeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Konstruktion von Risikokindern und beleuchtet, wie diese Konstruktionen in pädagogischen und politischen Kontexten entstehen und verwendet werden. Die Arbeit untersucht, welchen Kindern ein gewisses Risiko zugeschrieben wird und wie diese Zuschreibungen in politischen Feldern hergestellt werden.
- Die Entstehung und Verwendung von Risikokind-Konstruktionen in pädagogischen und politischen Kontexten
- Die Zuschreibung von Risiken an bestimmte Kindergruppen
- Die Rolle von politischen Feldern bei der Herstellung von Risikokind-Konstruktionen
- Die Bedeutung von Risikokind-Konstruktionen für die pädagogische Arbeit
- Die Auswirkungen von Risikofaktoren auf die kindliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Risikokind-Konstruktionen ein und erläutert den Fokus dieser Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Risikolagen von Kindern und Kindheit im Kontext gesellschaftlicher und politischer Diskussionen. Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Konstrukt von Kindheit und zeigt auf, wie Kinder und unter welchen Einflüssen konstruiert werden. Kapitel 4 fokussiert auf die Risikokinder-Konstruktionen aus dem politischen Feld und analysiert die Umsetzungen, die durch politische Felder geschaffen werden.
Kapitel 5 veranschaulicht Muster in der Diskussion um Risikokonstruktionen und untersucht die Funktionen dieser Konstruktionen. Kapitel 6 widmet sich der Frage nach der Bedeutung von Risikokonstruktionen von Kindern für die pädagogische Arbeit. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Schlüsselwörter
Risikokind, Risikokindheit, Kindheitskonstruktionen, pädagogische Arbeit, politische Kontexte, Frühförderung, Frühe Hilfen, Kindeswohlgefährdung, Bildungschancen, soziale Ausgrenzung, Migrationshintergrund.
- Quote paper
- Petra Engelhard (Author), 2016, Die Konstruktion des Begriffs "Risikokind". Welche Bedeutung hat sie für die pädagogische Arbeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/320498