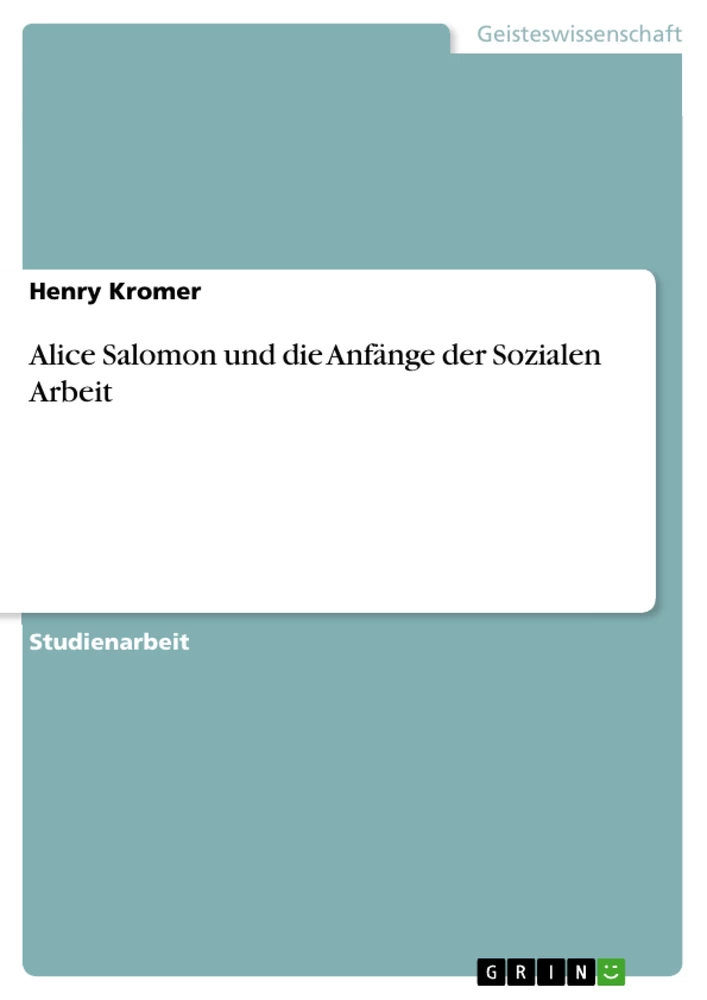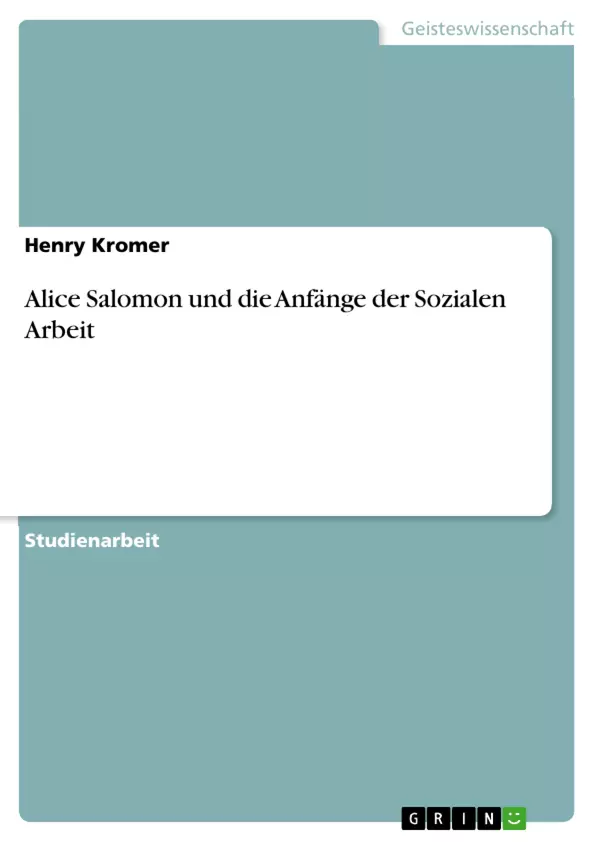Alice Salomon ist eine der wichtigsten Personen, wenn es darum geht, den Ursprung der Sozialen Arbeit zu benennen. Insbesondere in Deutschland hat sie das Bild der sozialen Berufe geprägt und sich darüber hinaus maßgeblich für die Rechte der Frauen weltweit engagiert. Alice Salomon war als Erzieherin, Lehrerin, Sozialarbeiterin tätig, ohne je eine Ausbildung in diesen Bereichen erhalten zu haben und wirkte darüber hinaus als Reformerin, Dozentin und Schriftstellerin. Sie erlebte die Regierungszeit von drei Kaisern, die Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozialismus und ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Sozialen Arbeit.
Ich möchte mich in dieser Arbeit auf ein paar wenige, aber zentrale Aspekte ihres Schaffens konzentrieren. Zu Beginn der vorliegenden Ausarbeitung werde ich mittels eines kurzen Einblicks in ihre Biografie, beginnend bei ihrer Kindheit bis hin zu ihrem 27. Lebensjahr, wo sich für sie bereits ihre 3 Interessenschwerpunkte, die sich durch ihr gesamtes Lebenswerk ziehen, herauskristallisiert haben, ihr Leben zusammenfassen. Im Anschluss möchte ich mich mit den Anfängen der Sozialen Arbeit auseinandersetzen, Salomons Einfluss auf die Ausbildung und den Begriff der Sozialen Arbeit, um am Ende die Frage nach der Bedeutung ihrer Tätigkeit für die heutige Soziale Arbeit beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biografie
- Kindheit, Schulzeit und familiärer Hintergrund (1872 – 1887)
- Untätige Zeit (1887 - 1892)
- Beginn ihres sozialen Wirkens (1893-1899)
- Anfänge der Sozialen Arbeit
- Der Begriff „Soziale Arbeit“ nach Alice Salomon
- Der Theorie-Begriff: Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft
- Salomons anthropologische Grundannahmen
- Die soziologischen Grundannahmen von Alice Salomon
- Die Entstehung der Sozialen Arbeit als Beruf
- Berufsidentität
- Berufsethik
- Erfolg der Schule
- Salomons Arbeit und ihre Bedeutung auf die heutige Soziale Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Belegarbeit befasst sich mit dem Leben und Wirken von Alice Salomon, einer bedeutenden Persönlichkeit in der Geschichte der Sozialen Arbeit, insbesondere in Deutschland. Die Arbeit untersucht ihre Biografie, ihre Rolle in der Entwicklung der Sozialen Arbeit als Berufsfeld und ihre Beiträge zur Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die Entstehung der Sozialen Arbeit als Beruf, ihre anthropologischen und soziologischen Grundannahmen und ihre Bedeutung für die heutige Soziale Arbeit.
- Alice Salomons Biografie und ihre prägenden Lebenserfahrungen
- Die Anfänge der Sozialen Arbeit und die Rolle von Alice Salomon
- Die Entwicklung der Sozialen Arbeit als Berufsfeld
- Salomons anthropologische und soziologische Grundannahmen
- Die Bedeutung von Alice Salomons Werk für die heutige Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine Einführung in das Thema und stellt die Bedeutung von Alice Salomon für die Soziale Arbeit dar. Die Biografie beleuchtet die Kindheit, Jugend und den Beginn des sozialen Wirkens von Alice Salomon, wobei ihre persönlichen und gesellschaftlichen Einflüsse im Fokus stehen. Der Abschnitt über die Anfänge der Sozialen Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff der Sozialen Arbeit nach Alice Salomon, ihrer Theorie und ihren anthropologischen und soziologischen Grundannahmen. Die Entstehung der Sozialen Arbeit als Beruf wird anhand der Entwicklung von Berufsidentität, Berufsethik und dem Erfolg der von Alice Salomon gegründeten Schule für Soziale Arbeit untersucht. Schließlich wird die Bedeutung von Alice Salomons Werk für die heutige Soziale Arbeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Alice Salomon, Soziale Arbeit, Biografie, Anfänge der Sozialen Arbeit, Berufsethik, Berufsidentität, Handlungswissenschaft, Anthropologie, Soziologie, Frauenbewegung, Geschichte der Sozialen Arbeit, Sozialer Wandel.
- Arbeit zitieren
- Henry Kromer (Autor:in), 2016, Alice Salomon und die Anfänge der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/320412