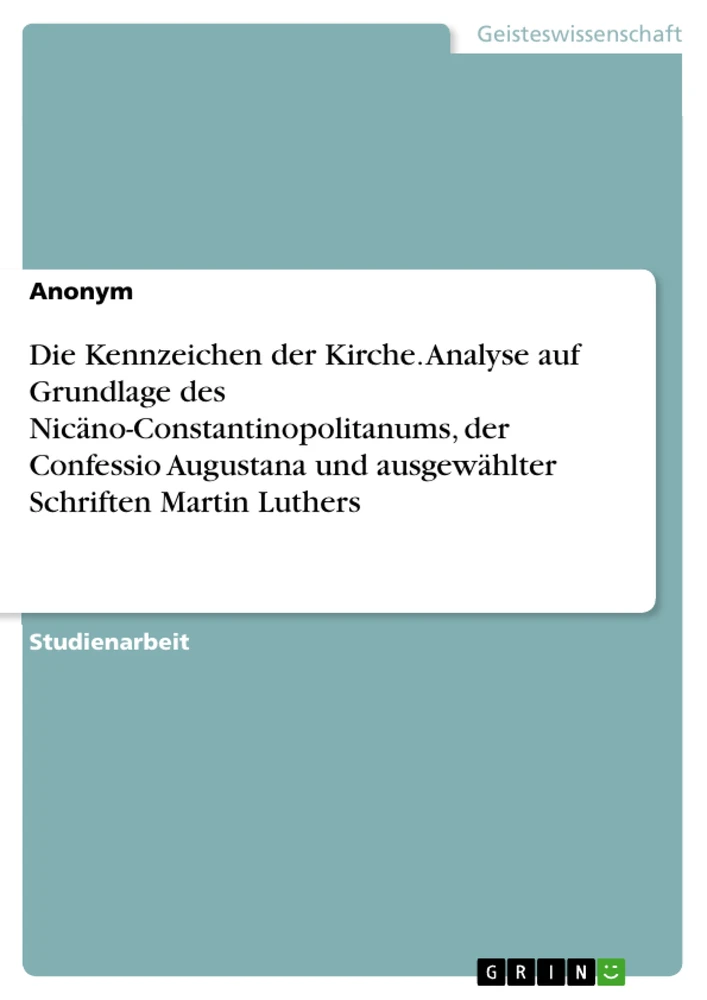Gegenstand der vorliegenden Hausarbeit ist das „Nicäno-Constantinopolitanum“, der 7. Artikel der „Confessio Augustana“ und einige Schriften Martin Luthers. Diese sollen auf ihre jeweilige Bestimmung der Kennzeichen für die Präsenz der wahren Kirche untersucht werden. Ziel ist es dabei, die jeweiligen Kennzeichen darzustellen, zu erläutern und zu bewerten. Dabei sollen die unterschiedlichen Auffassungen über die Kennzeichen der Kirche in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden und die Funktionalität der genannten Kennzeichen bewertet werden.
Um die Bedeutung und Funktion der im Folgenden beleuchteten Schriften über die Kennzeichen der Kirche gänzlich erschließen zu können, ist es unabdingbar, zuallererst zu klären, was „Kennzeichen“ hier meint. Wenn im Folgenden von den Kennzeichen der Kirche gesprochen wird, ist damit jeweils ein Kriterium gemeint, das die Präsenz der wahren Kirche anzeigen soll und für den Gläubigen als Unterscheidungsmerkmal und Abgrenzungsmerkmal von Kirche und Nicht-Kirche dienen soll. Überdies hinaus besteht jedoch bezüglich der Bestimmung der Kennzeichen sowohl auf diachroner als auch auf synchroner Ebene Uneinigkeit. So wurde bis heute in den christlichen Kirchen kein Konsens über die Kennzeichen selbst, die Anzahl der Kennzeichen sowie über das Verhältnis von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der Kennzeichen gefunden. Die Kennzeichen der Kirche stellen keine feststehende Größe dar, sondern sind gebunden an ihre geschichtliche Entwicklung, und variieren je nach Kirchen- und Glaubensverständnis. Anhand dreier Beispiele sollen nun nach chronologischen Gesichtspunkten verschiedene Definitionen der Kennzeichen sowie deren Bedeutung und Funktion dargelegt werden. Dazu ist es notwendig, die Motive und Hintergründe für die Entstehungen der Bekenntnisse zu betrachten. Diese sollen im Folgenden in aller Kürze den jeweiligen Analysen vorangestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kennzeichen der Kirche nach dem Nicäno-Constantinopolitanum
- Die Darstellung der notae ecclesiae
- Die unterschiedlichen Bewertungen der notae ecclesiae
- Die Kennzeichen der Kirche nach dem 7. Artikel der Confessio Augustana
- Die Darstellung des 7. Artikels der Confessio Augustana
- Die unterschiedlichen Bewertungen der Confessio Augustana
- Die Kennzeichen der Kirche nach den Schriften Luthers
- Luthers Einstellung zu den notae ecclesiae
- Luthers Einstellung zu dem 7. Artikel der Confessio Augustana
- Luthers eigene Lehre von den Kennzeichen der Kirche
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Definition der Kennzeichen der wahren Kirche im Nicäno-Constantinopolitanum, dem 7. Artikel der Confessio Augustana und ausgewählten Schriften Martin Luthers. Ziel ist die Darstellung, Erläuterung und Bewertung der jeweiligen Kennzeichen sowie die Analyse der unterschiedlichen Auffassungen und deren Funktionalität.
- Darstellung der „notae ecclesiae“ im Nicäno-Constantinopolitanum
- Analyse des 7. Artikels der Confessio Augustana und seiner sichtbaren Zeichen der Kirche
- Untersuchung von Luthers Auffassung der Kennzeichen der Kirche, inklusive seiner Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche
- Vergleich der verschiedenen Auffassungen über die Kennzeichen der Kirche
- Bewertung der Funktionalität der dargestellten Kennzeichen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt den Gegenstand der Untersuchung: das Nicäno-Constantinopolitanum, den 7. Artikel der Confessio Augustana und ausgewählte Schriften Martin Luthers. Es wird das Ziel der Arbeit formuliert, die jeweiligen Kennzeichen der Kirche darzustellen, zu erläutern und zu bewerten, sowie die unterschiedlichen Auffassungen in ein Verhältnis zueinander zu setzen und deren Funktionalität zu beurteilen. Die Einleitung erklärt den Begriff „Kennzeichen der Kirche“ und betont die Uneinigkeit über Anzahl, Inhalt und das Verhältnis von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der Kennzeichen in den christlichen Kirchen. Sie kündigt die Struktur der Arbeit an, die sich in drei Schritten vollzieht: die Analyse des Nicäno-Constantinopolitanums, die Betrachtung des 7. Artikels der Confessio Augustana und schließlich die ausführliche Untersuchung von Luthers Lehre zu den Kennzeichen der Kirche.
2. Die Kennzeichen der Kirche nach dem Nicäno-Constantinopolitanum: Dieses Kapitel untersucht die im Nicäno-Constantinopolitanum dargestellten Kennzeichen der Kirche. Es beleuchtet den historischen Kontext des Konzils von Nicäa und Konstantinopel, die Entstehung des Bekenntnisses und dessen Bedeutung als Grundlage für das ökumenische Gespräch. Der Fokus liegt auf der 9. Klausel des Bekenntnisses, die die „eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“ bekennt. Das Kapitel analysiert die Bedeutung dieser vier Kennzeichen und deren Implikationen für das Verständnis von Kirche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kennzeichen der Kirche nach Nicäno-Constantinopolitanum, Confessio Augustana und Luther
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Definition der Kennzeichen der wahren Kirche in drei Quellen: dem Nicäno-Constantinopolitanum, dem 7. Artikel der Confessio Augustana und ausgewählten Schriften Martin Luthers. Das Ziel ist die Darstellung, Erläuterung und Bewertung der jeweiligen Kennzeichen sowie die Analyse der unterschiedlichen Auffassungen und deren Funktionalität.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung der „notae ecclesiae“ im Nicäno-Constantinopolitanum, die Analyse des 7. Artikels der Confessio Augustana und seiner sichtbaren Zeichen der Kirche, die Untersuchung von Luthers Auffassung der Kennzeichen der Kirche (inklusive seiner Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche), einen Vergleich der verschiedenen Auffassungen über die Kennzeichen der Kirche und die Bewertung der Funktionalität der dargestellten Kennzeichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und eine Schlussbetrachtung. Kapitel 1 analysiert das Nicäno-Constantinopolitanum und seine Kennzeichen der Kirche. Kapitel 2 befasst sich mit dem 7. Artikel der Confessio Augustana. Kapitel 3 untersucht Luthers Lehre zu den Kennzeichen der Kirche. Die Einleitung führt in das Thema ein und die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die Kennzeichen der Kirche nach dem Nicäno-Constantinopolitanum?
Das Nicäno-Constantinopolitanum bekennt die „eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“. Die Arbeit analysiert die Bedeutung dieser vier Kennzeichen und deren Implikationen für das Verständnis von Kirche, unter Berücksichtigung des historischen Kontextes des Konzils von Nicäa und Konstantinopel.
Wie wird der 7. Artikel der Confessio Augustana behandelt?
Das Kapitel über die Confessio Augustana analysiert den 7. Artikel und seine sichtbaren Zeichen der Kirche. Es untersucht, wie die Confessio Augustana die Kennzeichen der Kirche definiert und wie sich diese Definition von der des Nicäno-Constantinopolitanums unterscheidet.
Welche Aspekte von Luthers Lehre werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Luthers Einstellung zu den notae ecclesiae, seine Einstellung zum 7. Artikel der Confessio Augustana und seine eigene Lehre von den Kennzeichen der Kirche. Ein besonderer Fokus liegt auf Luthers Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche.
Wie werden die verschiedenen Auffassungen verglichen?
Die Arbeit vergleicht die verschiedenen Auffassungen über die Kennzeichen der Kirche, die im Nicäno-Constantinopolitanum, der Confessio Augustana und in Luthers Schriften zum Ausdruck kommen. Sie analysiert die Übereinstimmungen und Unterschiede und bewertet deren Funktionalität.
Was ist die Schlussbetrachtung?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet eine abschließende Bewertung der untersuchten Kennzeichen der Kirche und deren Relevanz für das Verständnis von Kirche heute.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Die Kennzeichen der Kirche. Analyse auf Grundlage des Nicäno-Constantinopolitanums, der Confessio Augustana und ausgewählter Schriften Martin Luthers, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/319367