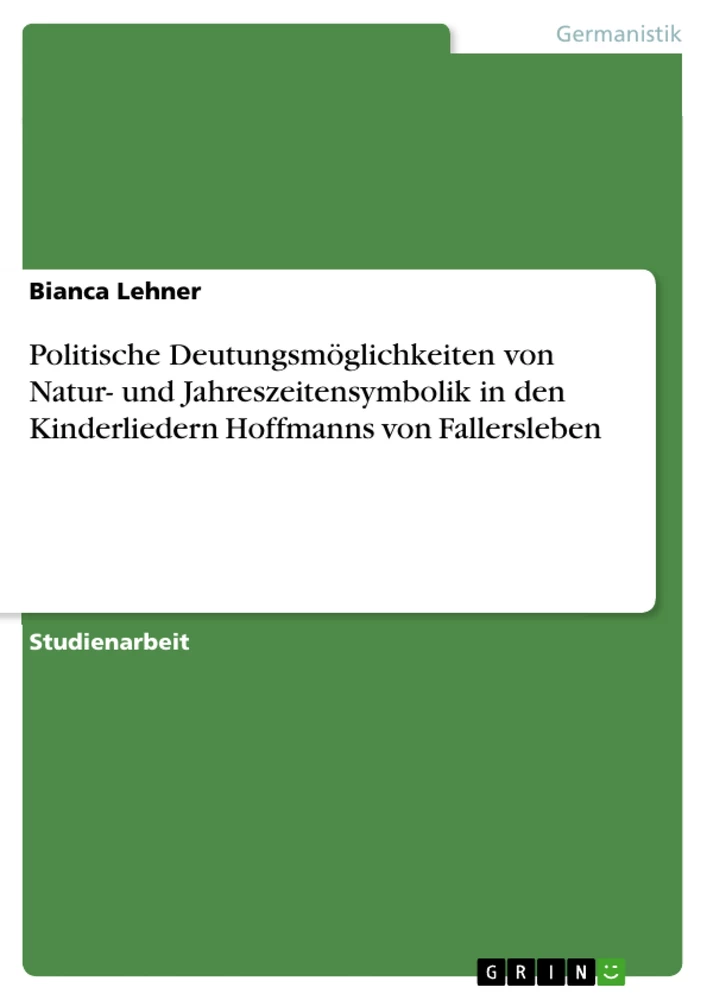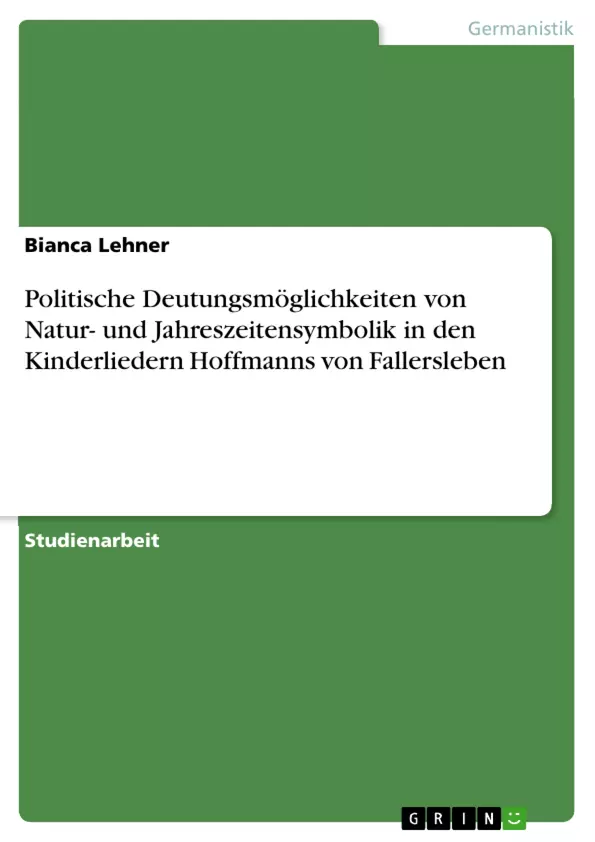Lieder wie „Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald“ oder „Winter ade“ werden auch heute gerne noch in Kindergärten und Volksschulen gesungen; über ihren Autor und ihre Entstehungszeit wissen jedoch die wenigsten Bescheid. Diese Kinderlieder August Heinrich Hoffmanns von Fallersleben entstanden zu einer Zeit, in der Literatur, insbesondere auch Lyrik, sehr stark politisch gefärbt bzw. auch instrumentalisiert war. Vom selben Urheber stammt ferner der Gedichtband „Unpolitische Lieder“, dessen Inhalte eben genau nicht – wie im Titel proklamiert – unpolitisch waren, sondern in verschleierter Form sehr stark Kritik an den Obrigkeiten und deren Privilegien übten.
Dies legt die Annahme nahe, dass selbst in den auf den ersten Blick unpolitisch anmutenden Kinderliedern – gewollt oder ungewollt – konnotativ politische Bedeutungen mitschwingen. Zusätzlich stützt sich diese These darauf, dass in etlichen der Lieder Natur- und Jahreszeitenbilder verwendet werden, welche sich in Deutschland nach der französischen Revolution als politisch motivierte Symbolträger etabliert haben.
In welchem Ausmaß sich derartige Symbole in den Kinderliedern August Heinrich Hoffmanns von Fallersleben wiederfinden, und in wieweit sie auch politisch interpretierbar sind, wird diese Arbeit behandeln. Zunächst wird in den ersten Kapiteln eine zeitliche Einordnung der Entstehung der Kinderlieder vorgenommen und durch einen kurzen Abriss der Autorenbiografie samt des lyrischen Umfelds in der Zeit des Vormärz untermauert, dass sowie warum sie potentiell politische Inhalte transportieren.
Das Hauptaugenmerk der Arbeit liegt im Anschluss daran in der ausführlichen Befassung mit dem Nachweis verschiedenster Natur- und Jahreszeitensymbole in den Kinderliedern. So werden nach einer kurzen Klärung des Symbolbegriffs in den nachfolgenden Kapiteln mögliche politische Deutungen dieser Symbole analog zu anderen Werken des Vormärz aufgezeigt. Abschließend werden in der Conclusio die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Das literarische Umfeld
- Der Autor und die Kinderlieder
- Der Begriff „Symbol“
- Jahreszeitensymbolik in den Kinderliedern
- Winter
- Frühling
- Natursymbolik in den Kinderliedern
- Wald
- Tiere
- Ströme
- Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert die Kinderlieder von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben im Hinblick auf ihre politische Bedeutung, insbesondere im Kontext der Natur- und Jahreszeitensymbolik, die in ihnen verwendet wird. Der Fokus liegt darauf, herauszufinden, inwieweit diese Symbole im Vormärz als politische Träger dienten und ob sich diese Interpretation auf die Kinderlieder übertragen lässt. Die Arbeit verfolgt die Zielsetzung, die politischen Konnotationen in den vermeintlich unpolitischen Kinderliedern aufzudecken.
- Politische Instrumentalisierung der Literatur im Vormärz
- Symbolische Bedeutung von Natur und Jahreszeiten in der Literatur
- Analyse der Kinderlieder Hoffmanns von Fallersleben auf politische Konnotationen
- Die Bedeutung von „operativer Literatur“ im Vormärz
- Die Rolle von Kinderliedern als Erziehungsmittel und politisches Instrument
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die These auf, dass auch in Kinderliedern, die auf den ersten Blick unpolitisch erscheinen, politische Bedeutungen mitschwingen können. Das erste Kapitel beleuchtet das literarische Umfeld der Kinderlieder und zeigt auf, wie Literatur im Vormärz zunehmend politisch gefärbt war und als Instrument der Meinungsbildung genutzt wurde.
Das zweite Kapitel behandelt die Biographie von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und seine Rolle als Autor von Kinderliedern. Hier wird erläutert, warum es plausibel ist, dass seine Kinderlieder trotz ihrer scheinbar unpolitischen Inhalte politische Konnotationen tragen.
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Analyse von Natur- und Jahreszeitenbildern in den Kinderliedern. Zunächst wird der Begriff „Symbol“ geklärt, um im weiteren Verlauf der Arbeit die Analyse der Symbole in den Kinderliedern zu ermöglichen.
Im Anschluss werden die Kapitel „Winter“ und „Frühling“ die Jahreszeitensymbolik in den Liedern analysieren und aufzeigen, wie sie im Kontext des Vormärz politische Bedeutungen annehmen können.
Die Kapitel über die Natursymbolik betrachten die Motive Wald, Tiere und Ströme in den Kinderliedern und beleuchten deren potentielle politische Konnotationen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Kinderlieder von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben im Kontext der politischen Literatur des Vormärz. Sie untersucht die politische Instrumentalisierung von Literatur, die Symbolkraft von Natur und Jahreszeiten sowie die Bedeutung von "operativer Literatur" im Vormärz. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kinderlieder, Vormärz, politische Lyrik, Symbol, Jahreszeiten, Natur, politische Deutung, "operative Literatur" und Erziehungsliteratur.
- Quote paper
- Bianca Lehner (Author), 2016, Politische Deutungsmöglichkeiten von Natur- und Jahreszeitensymbolik in den Kinderliedern Hoffmanns von Fallersleben, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/318698