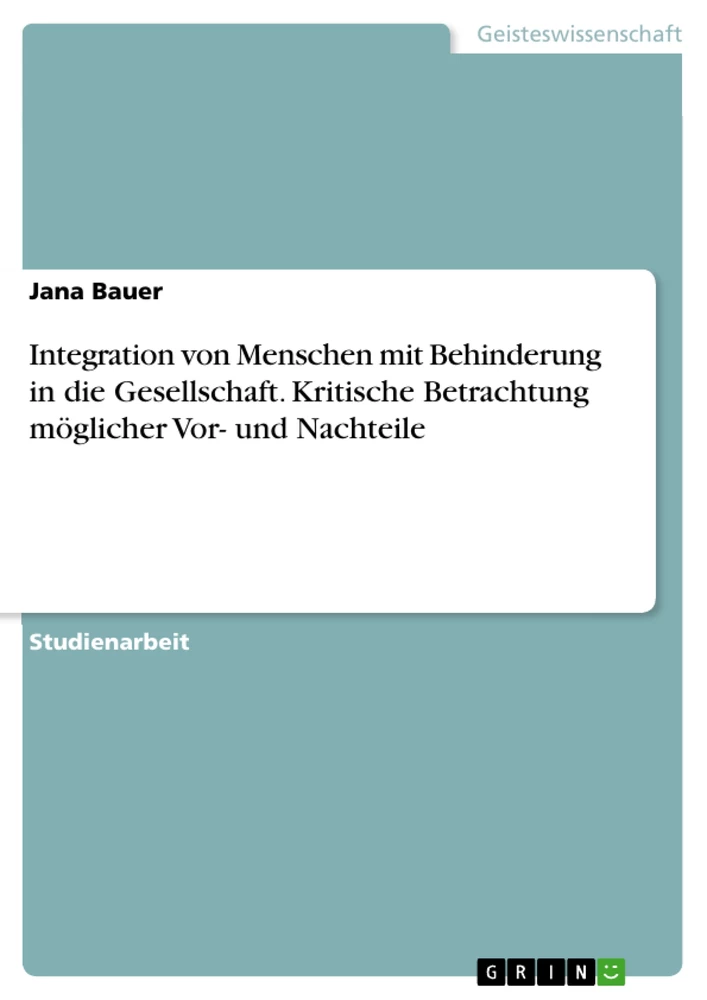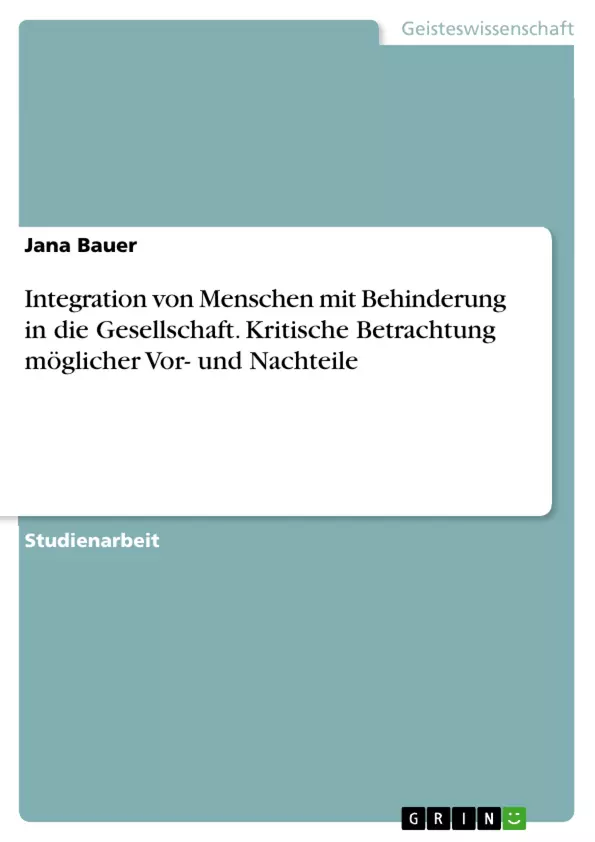In der Hausarbeit werden die Begriffe Inklusion und Integration näher erläutert. Es wird ein Einblick in den Umgang mit Menschen mit Behinderung im Verlaufe der Zeit gegeben und auf die Vor- und Nachteile von Integration eingegangen. Abschließend wird ein Resümee gezogen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Umgang mit Menschen mit Behinderung im Verlaufe der Zeit
- Nachteile einer Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft
- Vorteile einer Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert die Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Sie befasst sich mit der historischen Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung und beleuchtet die Vor- und Nachteile einer Integration. Ziel ist es, die Problematik der Integration aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und kritisch zu hinterfragen.
- Historische Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung
- Nachteile einer Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft
- Vorteile einer Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft
- Diskussion der Begriffe "Inklusion" und "Integration"
- Die Rolle des Grundgesetzes und der Behindertenrechtskonvention (BRK)
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Integration von Menschen mit Behinderung ein und stellt die Problematik aus verschiedenen Perspektiven dar. Es werden die Schwierigkeiten und Chancen der Integration sowie die Bedeutung des Grundgesetzes und der BRK beleuchtet.
- Umgang mit Menschen mit Behinderung im Verlaufe der Zeit: Dieses Kapitel betrachtet die historische Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung von der Antike bis zur Gegenwart. Es werden die unterschiedlichen Ansätze und Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung in verschiedenen Epochen beleuchtet, von der Tötung in der Antike über die Euthanasie im Nationalsozialismus bis hin zu den heutigen Diskussionen um Inklusion und Integration.
- Nachteile einer Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die negativen Aspekte einer Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Es wird argumentiert, dass Menschen mit Behinderung in der heutigen Leistungsgesellschaft einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt sind und unter der Gefahr von Vorurteilen und Diskriminierung leiden können.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte dieser Arbeit sind: Menschen mit Behinderung, Integration, Inklusion, Behindertenrechtskonvention (BRK), Grundgesetz, gesellschaftliche Teilhabe, Diskriminierung, Leistungsgesellschaft, Vorurteile, historische Entwicklung, Euthanasie, Exklusion.
- Quote paper
- Jana Bauer (Author), 2015, Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Kritische Betrachtung möglicher Vor- und Nachteile, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/318348