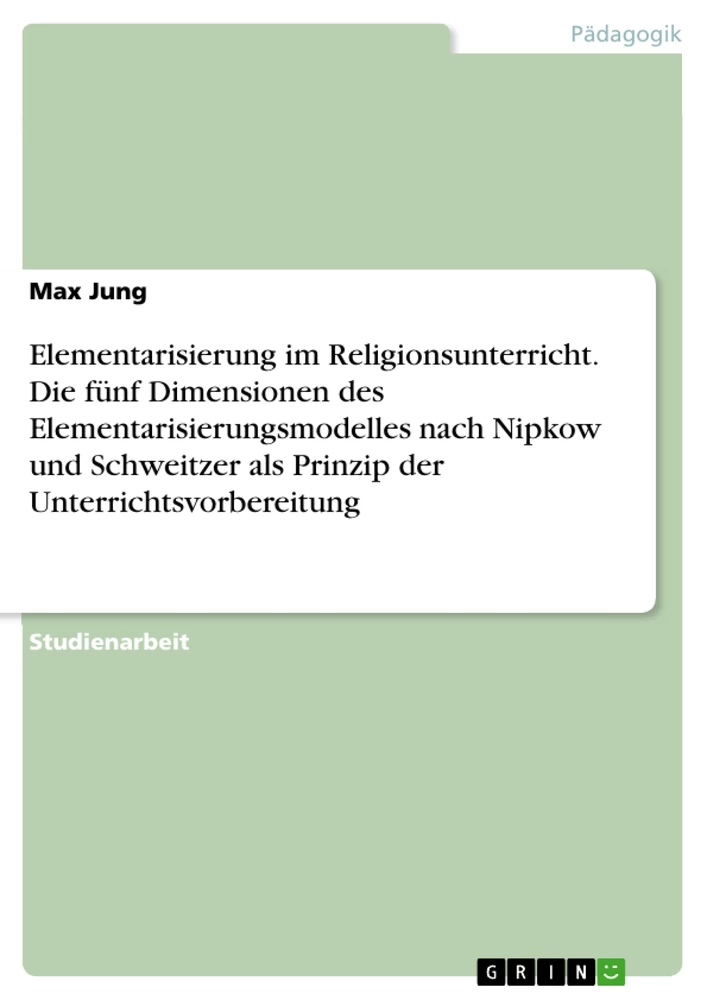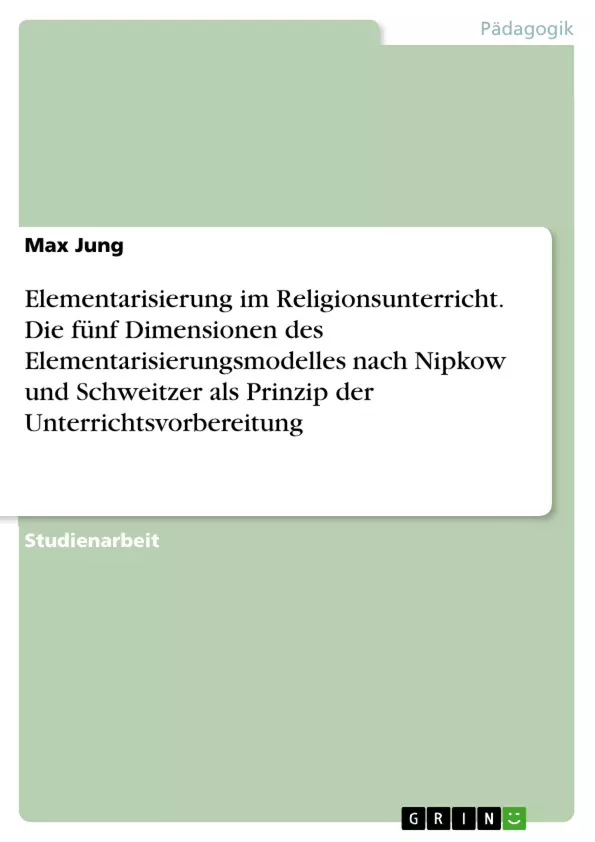Der Begriff der didaktischen Reduktion kann für jede Fachdisziplin Anwendung finden. Im Religionsunterricht findet natürlich auch eine Form der didaktischen Reduktion ihren Platz: das so genannte Elementarisierungsmodell.
In meiner Arbeit soll eben dieses Elementarisierungsmodell als Grundlage dienen. Im Folgenden werde ich kurz auf den eigentlichen Begriff der Elementarisierung eingehen und die Entstehung des Elementarisierungsmodells nach Karl Ernst Nipkow und Friedrich Schweitzer darstellen. Eine genaue Aufteilung des Modells in fünf Dimensionen soll dessen Tiefe verdeutlichen. In Kapitel 4, soll das Elementarisierungsmodell als Prinzip der Unterrichtsvorbereitung genauer betrachtet und eine Überlegung angestellt werden, wie Religionslehrer und -lehrerinnen dieses für Ihren Unterricht fruchtbar machen können. Gegen Ende meiner Arbeit möchte ich versuchen, drei der fünf Dimensionen am Beispiel des Gleichnisses vom verlorenen Sohn (LK 15, 11-32) möglichst praxisnah zu verdeutlichen.
Zum täglichen Brot eines jeden Lehrers gehört auch die Vorbereitung von Unterricht und damit auch die Überlegung, wie man Schülern einen (komplexeren) Sachverhalt näher bringt. Nun gibt es viele Ansätze, welche die Weitergabe von Lernstoff beschreiben und vereinfachen sollen. Der wohl am häufigsten verwendete Ansatz ist die so genannte didaktische Reduktion. „Man versteht darunter alle Maßnahmen, komplexe, umfangreiche oder schwierige Unterrichtsstoffe so zu verfeinern (...), dass sie von Schüler/innen eines bestimmten Lern- und Entwicklungsalters, aufgenommen und verstanden werden können“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung und Entstehung
- Begriffserklärung
- Entstehung nach Nipkow und Schweitzer
- Die fünf Dimensionen des Elementarisierungsmodells
- Elementare Struktur
- Elementare Erfahrungen
- Elementare Zugänge
- Elementare Wahrheiten
- Elementare Lernwege
- Elementarisierung als Unterrichtsvorbereitung
- Elementarisierung am Beispiel des verlorenen Sohns
- Elementare Struktur am Beispiel Lk 15, 11-32
- Elementare Erfahrungen am Beispiel Lk 15, 11-32
- Elementare Zugänge am Beispiel Lk 15, 11-32
- Fazit / Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Elementarisierungsmodell als Grundlage für die Vorbereitung und Gestaltung von Religionsunterricht. Sie beleuchtet die Entstehung des Modells, die fünf Dimensionen des Modells und zeigt am Beispiel des Gleichnisses vom verlorenen Sohn (Lk 15, 11-32) auf, wie das Elementarisierungsmodell in der Praxis angewendet werden kann.
- Der Begriff der Elementarisierung und seine Bedeutung für die Religionspädagogik
- Die Entwicklung des Elementarisierungsmodells durch Karl Ernst Nipkow und Friedrich Schweitzer
- Die fünf Dimensionen des Elementarisierungsmodells und ihre praktische Anwendung im Religionsunterricht
- Die Verwendung des Elementarisierungsmodells als Prinzip der Unterrichtsvorbereitung
- Die Bedeutung des Elementarisierungsmodells für die Gestaltung von Religionsunterricht, der für Schülerinnen und Schüler zugänglich, einsichtig und grundlegend bedeutsam ist.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung der Unterrichtsvorbereitung für Lehrerinnen und Lehrer. Sie stellt das Elementarisierungsmodell als einen Ansatz zur didaktischen Reduktion vor und erläutert die Notwendigkeit eines verständlichen und nachvollziehbaren Religionsunterrichts.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Begriffserklärung und Entstehung des Elementarisierungsmodells. Es wird die Bedeutung des Begriffs „Element“ im wissenschaftlichen Kontext beleuchtet und der Elementarisierungsansatz als vereinfachter Zugang zu komplexen Themen dargestellt. Die Entstehung des Elementarisierungsmodells wird anhand der Beiträge von Johann Heinrich Pestalozzi, Wolfgang Klafki, Karl Ernst Nipkow und Friedrich Schweitzer erläutert.
Das dritte Kapitel beschreibt die fünf Dimensionen des Elementarisierungsmodells: Elementare Struktur, Elementare Erfahrungen, Elementare Zugänge, Elementare Wahrheiten und Elementare Lernwege. Jede Dimension wird ausführlich erläutert und ihre Bedeutung für die Gestaltung von Religionsunterricht hervorgehoben.
Das vierte Kapitel widmet sich der Elementarisierung als Prinzip der Unterrichtsvorbereitung. Es werden Überlegungen angestellt, wie Religionslehrerinnen und Religionslehrer das Elementarisierungsmodell für ihren Unterricht fruchtbar machen können.
Das fünfte Kapitel zeigt am Beispiel des Gleichnisses vom verlorenen Sohn (Lk 15, 11-32) auf, wie drei der fünf Dimensionen des Elementarisierungsmodells in der Praxis angewendet werden können. Es werden die elementare Struktur, die elementaren Erfahrungen und die elementaren Zugänge des Gleichnisses erläutert.
Schlüsselwörter
Elementarisierung, Religionspädagogik, Didaktik, Unterrichtsvorbereitung, Elementarisierungsmodell, Nipkow, Schweitzer, Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lk 15, 11-32, elementare Struktur, elementare Erfahrungen, elementare Zugänge, elementare Wahrheiten, elementare Lernwege.
- Quote paper
- Max Jung (Author), 2015, Elementarisierung im Religionsunterricht. Die fünf Dimensionen des Elementarisierungsmodelles nach Nipkow und Schweitzer als Prinzip der Unterrichtsvorbereitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/317086