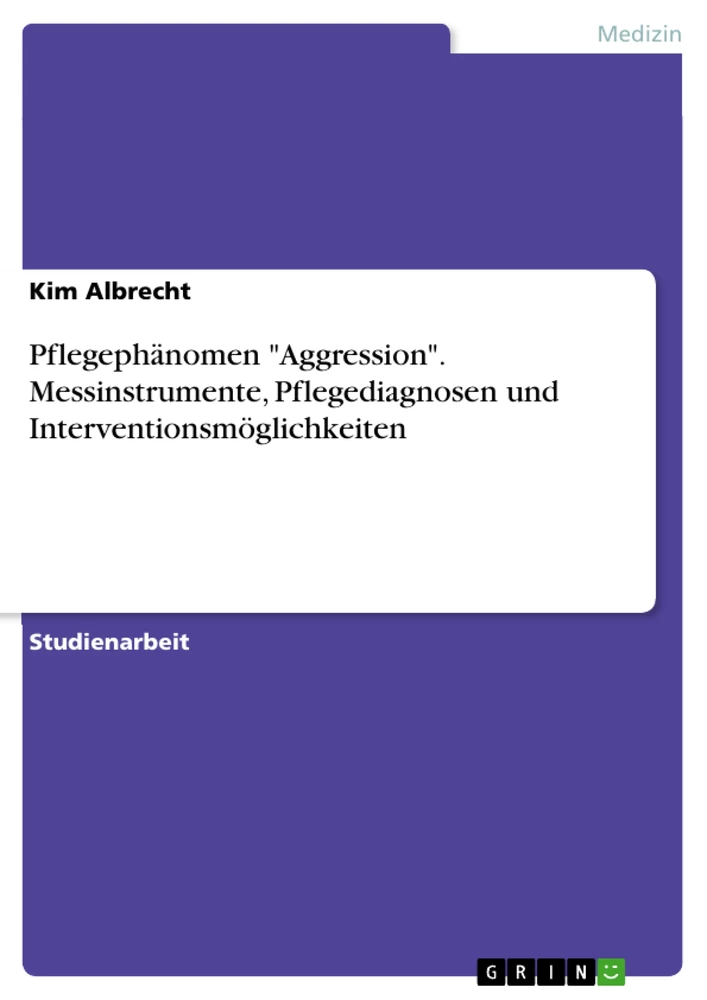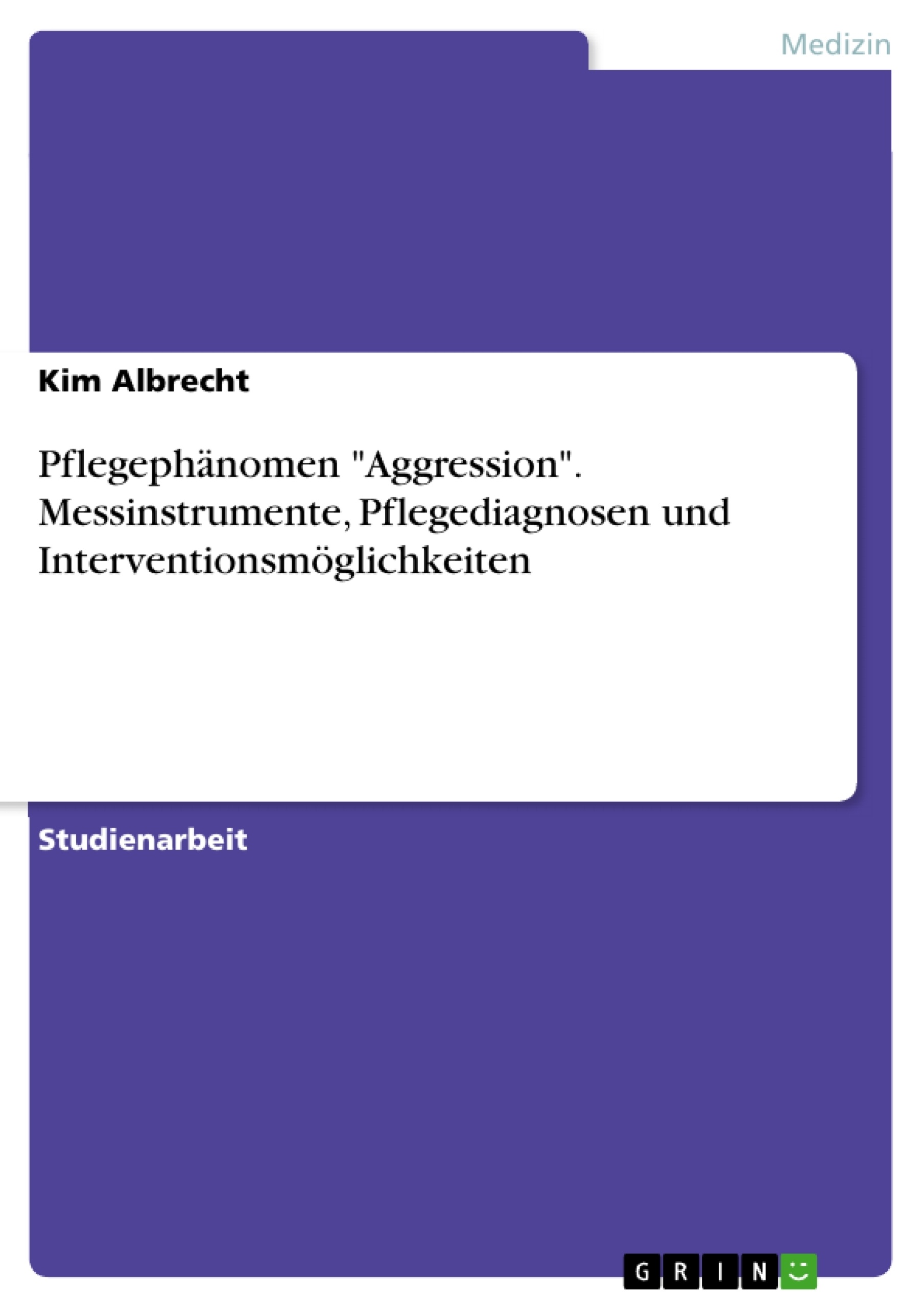Vorliegende Hausarbeit untersucht "Aggression" schwerpunktmäßig im Hinblick auf unterschiedliche Möglichkeiten der Messung des Phänomens und sich daran anschließende Pflegediagnosen, Interventionen und deren Outcomes. Der diagnostische Prozess wird anhand von zahlreichen Beispielen und Realitätsbezügen veranschaulicht.
Es gibt eine Vielzahl an Definitionen, welche das Phänomen der Aggression beschreiben. So ist es ungemein schwer, genaue Aussagen treffen zu können. Die Literatur beschreibt "Aggression" immer als ein absichtlich schädliches Verhalten (psychisch und/oder physisch) gegenüber Dingen, Menschen und Tieren. Dies wird in differenzierter Art und Weise dargestellt, mit einer Vielzahl an Faktoren, welche die Aggression beeinflussen.
Beeinflussende Faktoren und Indikatoren geben Auskunft darüber, welche Bedeutung und Auswirkung das Phänomen der Aggression hat. Die Wechselseitigkeit zwischen den beeinflussenden Faktoren und Auswirkung kann das Phänomen verstärken.
Internationale Assessmentinstrumente beschreiben Items, mit welchem man die Aggression messen kann, sowohl prospektiv als auch die Aggression selbst. Durch ein adäquates Messinstrument kann eine gute Einschätzung der Situation durch die Pflegediagnostik erfolgen, um passende Interventionen, die eine gute Validität und Reliabilität haben, einleiten zu können.
Patientenergebnisse nach der Pflegeergebnisklassifikation NOC können Auskunft darüber geben, ob und wie eine Intervention wirksam ist.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Definitionen
- 3 Faktoren, welche die Aggression beeinflussen und Indikatoren für das Phänomen
- 4 Auswirkungen und die Bedeutung des Phänomens…..\n1
- 5 Möglichkeiten, um das Phänomen zu erfassen und zu messen.
- 6 NANDA Pflegediagnosen zu Aggression......
- 7 Evidencebasierte Interventionen..
- 8 Auswahl passender Pflege-Outcomes (NOC) zum Phänomen „Aggression“.
- 9 Fazit und Persönlicher Lerngewinn....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Aggression im Pflegekontext. Sie soll einen umfassenden Überblick über die Definitionen, beeinflussenden Faktoren, Auswirkungen und Möglichkeiten zur Erfassung und Messung von Aggression liefern. Darüber hinaus werden relevante NANDA-Pflegediagnosen, evidence-basierte Interventionen und Pflege-Outcomes (NOC) vorgestellt. Ziel ist es, Pflegefachkräften ein tieferes Verständnis für das Phänomen der Aggression zu vermitteln und ihnen praktische Hilfestellungen für die professionelle Begleitung von Patienten mit aggressivem Verhalten zu bieten.
- Definitionen und verschiedene Perspektiven auf Aggression
- Faktoren, die Aggression beeinflussen und Indikatoren für das Phänomen
- Auswirkungen und Bedeutung von Aggression im Pflegekontext
- Möglichkeiten zur Erfassung und Messung von Aggression
- Evidence-basierte Interventionen bei aggressivem Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Aggression im Pflegekontext ein und erläutert die Relevanz des Themas. Es wird auf die Vielfältigkeit der Definitionen und die Bedeutung der Erfassung und Messung von Aggression eingegangen. Die Arbeit soll einen umfassenden Überblick über das Thema bieten und praktische Hilfestellungen für die professionelle Begleitung von Patienten mit aggressivem Verhalten liefern.
- Kapitel 2: Definitionen
Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen von Aggression aus unterschiedlichen Perspektiven. Es werden verschiedene wissenschaftliche Definitionen von Aggression vorgestellt, wobei auf die unterschiedlichen Schwerpunkte und Perspektiven der einzelnen Definitionen eingegangen wird. Des Weiteren wird auf die spezifische Bedeutung des Begriffs „Aggression“ im Pflegekontext eingegangen.
- Kapitel 3: Faktoren, welche die Aggression beeinflussen und Indikatoren für das Phänomen
Das Kapitel beleuchtet verschiedene Faktoren, die Aggression beeinflussen können. Es werden sowohl interne Faktoren wie z.B. psychische Erkrankungen und Persönlichkeitsmerkmale als auch externe Faktoren wie z.B. Umweltbedingungen und soziale Interaktionen betrachtet. Des Weiteren werden Indikatoren für das Phänomen der Aggression vorgestellt, die es ermöglichen, frühzeitig aggressive Verhaltensweisen zu erkennen.
- Kapitel 4: Auswirkungen und die Bedeutung des Phänomens…..\n1
Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen von Aggression auf verschiedene Ebenen. Es werden sowohl die Auswirkungen auf den Einzelnen (z.B. psychische und physische Gesundheit) als auch die Auswirkungen auf die soziale Umgebung (z.B. Beziehungen, Arbeitsklima) beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen von Aggression im Pflegekontext und den Herausforderungen, die für Pflegefachkräfte entstehen können.
- Kapitel 5: Möglichkeiten, um das Phänomen zu erfassen und zu messen.
Das Kapitel widmet sich den verschiedenen Methoden, die zur Erfassung und Messung von Aggression eingesetzt werden können. Es werden sowohl objektive Messmethoden (z.B. Verhaltensskalen) als auch subjektive Messmethoden (z.B. Interviews, Fragebögen) vorgestellt. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden sowie die Bedeutung einer adäquaten Auswahl des Messinstruments diskutiert.
- Kapitel 6: NANDA Pflegediagnosen zu Aggression......
Dieses Kapitel stellt relevante NANDA-Pflegediagnosen im Zusammenhang mit Aggression vor. Es werden die wichtigsten Pflegediagnosen beschrieben, die in der Praxis Anwendung finden, und es wird auf die spezifischen Merkmale und Symptome der einzelnen Diagnosen eingegangen. Die Pflegediagnosen dienen als Grundlage für die Planung und Durchführung von pflegerischen Interventionen.
- Kapitel 7: Evidencebasierte Interventionen..
Dieses Kapitel stellt verschiedene evidence-basierte Interventionen bei aggressivem Verhalten vor. Es werden sowohl psychologische Interventionen (z.B. Kognitive Verhaltenstherapie) als auch medikamentöse Interventionen (z.B. Antidepressiva) vorgestellt. Die Interventionsmöglichkeiten werden im Hinblick auf ihre Wirksamkeit, Anwendbarkeit und den Einsatz im Pflegekontext beurteilt.
- Kapitel 8: Auswahl passender Pflege-Outcomes (NOC) zum Phänomen „Aggression“
Das Kapitel stellt relevante Pflege-Outcomes (NOC) zur Messung des Erfolgs von Interventionen bei aggressivem Verhalten vor. Es werden die wichtigsten NOC-Outcomes beschrieben, die in der Praxis Anwendung finden, und es wird auf die spezifischen Messkriterien der einzelnen Outcomes eingegangen. Die NOC-Outcomes dienen als Leitfaden zur Evaluation der Wirksamkeit von Pflegeinterventionen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Aggression, Pflegediagnosen, Interventionen, Outcomes, NANDA-I, NOC, Evidence-basierte Pflege, Patientensicherheit, Kommunikation und Deeskalation. Die vorgestellten Inhalte dienen dazu, ein tieferes Verständnis für das Phänomen der Aggression im Pflegekontext zu vermitteln und Pflegefachkräften praktische Hilfestellungen für die professionelle Begleitung von Patienten mit aggressivem Verhalten zu bieten.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird „Aggression“ im Pflegekontext definiert?
Aggression wird als absichtlich schädliches Verhalten (psychisch oder physisch) gegenüber Dingen, Menschen oder Tieren beschrieben, beeinflusst durch eine Vielzahl von Faktoren.
Welche Messinstrumente gibt es für Aggression in der Pflege?
Es werden internationale Assessmentinstrumente und Verhaltensskalen genutzt, um Aggression sowohl prospektiv als auch im akuten Zustand zu erfassen.
Was sind NANDA-Pflegediagnosen zu Aggression?
Dies sind standardisierte Diagnosen, die Pflegefachkräften helfen, aggressives Verhalten systematisch zu erfassen und als Grundlage für die Interventionsplanung zu nutzen.
Welche evidence-basierten Interventionen sind wirksam?
Die Arbeit stellt psychologische Ansätze (wie Deeskalation) und medikamentöse Möglichkeiten vor, die eine hohe Validität und Reliabilität aufweisen.
Was sind NOC-Pflegeergebnisse?
NOC (Nursing Outcomes Classification) dient dazu, die Wirksamkeit von Pflegeinterventionen anhand von messbaren Patientenergebnissen zu evaluieren.
- Arbeit zitieren
- Kim Albrecht (Autor:in), 2015, Pflegephänomen "Aggression". Messinstrumente, Pflegediagnosen und Interventionsmöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/315686