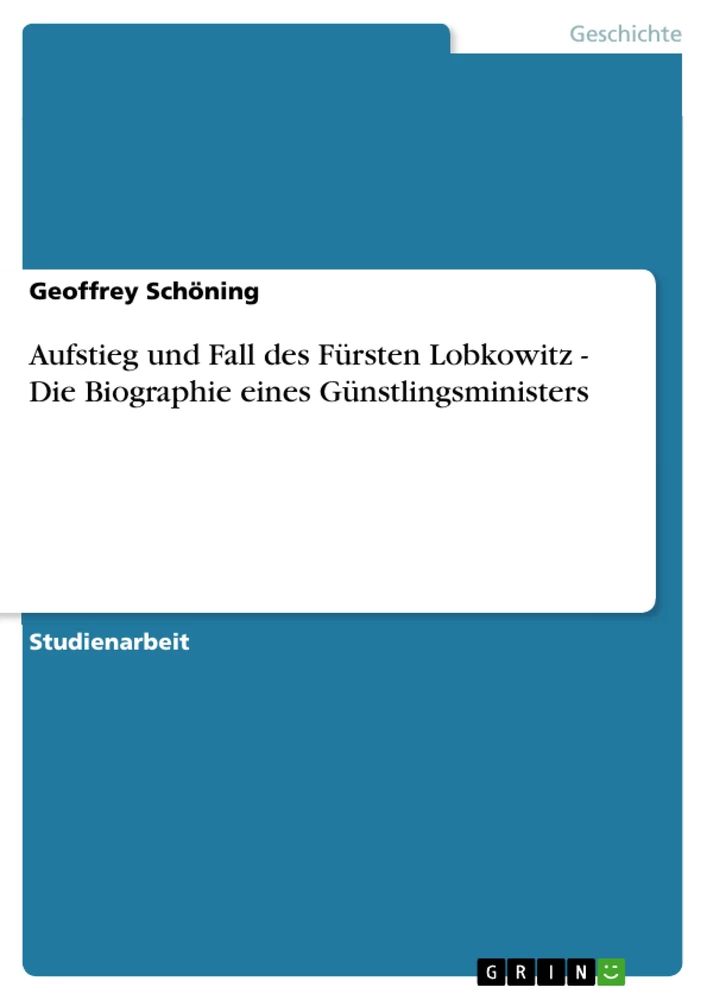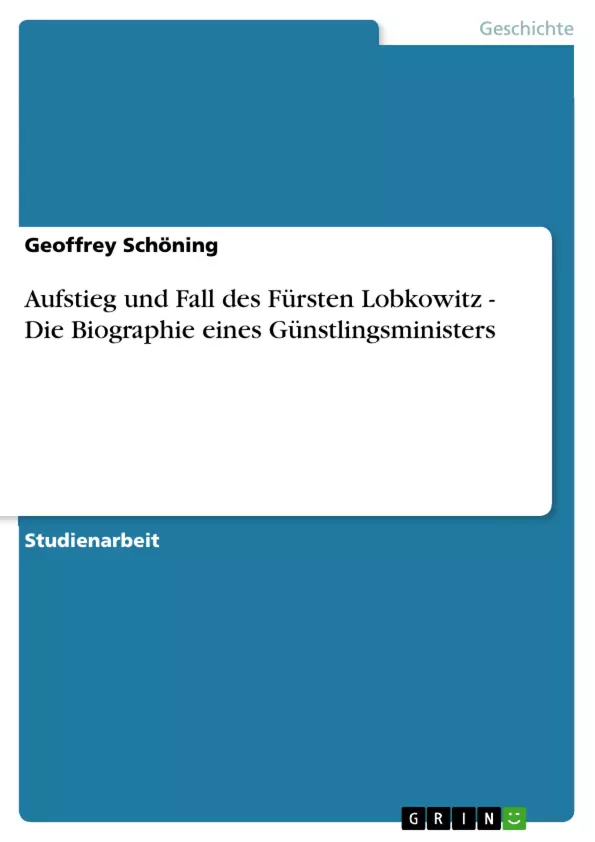Einleitung
L‘empereur n‘est pas comme votre roi, qui voit et fait tout de lui-même; car il est comme une statue que l‘on veut et que l‘on redresse à son plaisir.(1)
Ein freimütiger Ausdruck der Bewunderung an den französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. Dieses Zitat stammt nicht etwa aus dem Munde eines unbedeutenden Diplomaten, formuliert wurde es von einem Staatsmann ersten Ranges: Fürst Wenzel Eusebius Lobkowitz, zu jenem
Zeitpunkt Obersthofmeister und engster Berater des Römischen Kaisers. In den Jahren seiner Präsenz sollte sich das Haus Habsburg für eine kurze Zeit Frankreich annähern, sollte Österreich dem französischen König freie Hand in seiner Hegemonialpolitik lassen.
Behauptet der Minister hier also mit Fug und Recht, den Kaiser nach Belieben zu dirigieren – vielleicht sogar im Format eines Richilieus oder Mazarins? Wie groß war der Einfluss des böhmischen Adligen wirklich? Diese Frage soll das Thema der vorliegenden
Arbeit sein. Sie beschäftigt sich mit einem Aspekt der Geschichtswissenschaft, der erst vor rund 30 Jahren mit der Arbeit des Soziologen Norbert Elias2 reges Interesse fand: Die höfische Gesellschaft. Einhergehend mit der Neubeurteilung des Hofes in seiner politischen, sozialen und kulturellen Bedeutung, wurde auch die Rolle der informellen Machtverteilung neu bewertet. Gegen die Eliassche These vom „Hof als Herrschaftsinstrument des Königs“
meldeten sich bald Kritiker zu Wort. Die Aristokratie ziehe ebenso Vorteile aus der Nähe zum Herrscher, so ihre einhellige Meinung, nicht zuletzt durch direkte Einflussnahme auf die Politik.
[...]
_____
1 François A. M. A. Mignet (Hg.): Négociations relatives à la succession d‘Espagne sous Louis XIV., ou Correspondances, mémoires, et actes diplomatiques concernant les prétentions et l’avènement de la maison de Bourbon au trône d‘Espagne, Bd. 2, Paris 1835, S. 383.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Aufstieg: vom Schlachtfeld in die Diplomatie
- Schlüssel zum Erfolg? Eine Charakterstudie Leopold I.
- Züge eines Potentaten? Lobkowitz und sein Auftreten
- Entscheidende Wende: die Rivalität zu Auersperg
- Verkannter Souverän? Leopolds Wunsch nach Selbstregierung
- Im Schulterschluss mit Frankreich? Der Sturz des Auersperg
- Isoliert an der Spitze: Lobkowitz auf der Höhe seiner Macht
- Der Fall: mit dem Umschwung der Politik das persönliche Aus
- Kritik rein politischer Natur? Höflinge im Kampf gegen den Fürsten
- Unerwartetes Ende? Die Verbannung aus Wien
- Historische Vorbilder: Favoriten in der Wissenschaft
- Strippenzieher oder kaiserliche Marionette? Ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Aufstieg und Fall des Fürsten Wenzel Eusebius Lobkowitz, einem einflussreichen Adligen am Hof des Kaisers Leopold I. Sie analysiert Lobkowitz’ Einfluss auf den Kaiser und die kaiserliche Politik, insbesondere in den Jahren seiner höchsten Macht.
- Der Aufstieg Lobkowitz’ vom Schlachtfeld in die Diplomatie und seine Rolle in der Kaiserwahl Leopolds I.
- Die Persönlichkeit und die Regierungsweise Leopolds I. und ihr Einfluss auf Lobkowitz’ Machtposition.
- Lobkowitz’ Verhältnis zu seinen politischen Gegnern, insbesondere zur Familie Auersperg.
- Die Frage nach Lobkowitz’ eigenem politischen Programm und seinen Motiven.
- Der Fall Lobkowitz’ und die Gründe für seinen Verlust an Einfluss.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Untersuchung und die zentrale Forschungsfrage umreißt: Inwiefern war Lobkowitz ein „Günstlingsminister“ und wie groß war sein tatsächlicher Einfluss auf den Kaiser?
Kapitel 2 beschreibt den Aufstieg des Fürsten Lobkowitz, angefangen mit seiner Karriere in der kaiserlichen Armee bis hin zu seiner Rolle in der Wahl Leopolds I. zum deutschen Kaiser. Die Bedeutung des 30-jährigen Krieges für Lobkowitz’ Karriere und seine Rolle als Diplomat werden dabei hervorgehoben.
Kapitel 2.1 untersucht die Persönlichkeit und die Regierungsweise Leopolds I. und stellt die Frage, inwiefern der Kaiser durch Lobkowitz beeinflusst wurde.
Kapitel 2.2 analysiert Lobkowitz’ Auftreten und die Frage, ob er seinen Einfluss bewusst und gezielt zur Durchsetzung seiner eigenen Ziele nutzte.
Kapitel 3 behandelt die entscheidende Wende in Lobkowitz’ Karriere: die Rivalität mit der Familie Auersperg. Das Kapitel beleuchtet die Konflikte zwischen Lobkowitz und Auersperg und untersucht die politischen Hintergründe dieser Rivalität.
Kapitel 3.1 befasst sich mit der Frage, ob Leopold I. tatsächlich nach einer selbstständigen Regierungsweise strebte, oder ob er von seinen Ministern, insbesondere Lobkowitz, gesteuert wurde.
Kapitel 3.2 analysiert die Bündnisse zwischen Lobkowitz und Frankreich und die Rolle dieser Bündnisse im Sturz der Familie Auersperg.
Kapitel 4 beleuchtet Lobkowitz’ Position an der Spitze der kaiserlichen Politik und die Folgen seiner Macht für die österreichische Politik.
Kapitel 5 beschreibt den Fall Lobkowitz’ und untersucht die Gründe für seinen Verlust an Einfluss. Es wird auch die Frage nach der Rolle von Hofintrigen und politischen Gegnern im Sturz des Fürsten behandelt.
Kapitel 5.1 untersucht die Kritik an Lobkowitz und die Frage, ob diese rein politischer Natur war oder ob es persönliche Gründe für seinen Sturz gab.
Kapitel 5.2 befasst sich mit der Verbannung Lobkowitz’ aus Wien und den Folgen dieses Ereignisses.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der höfischen Gesellschaft, dem Einfluss von Günstlingen auf die Politik, der Rolle des Kaisers Leopold I., dem Aufstieg und Fall von Fürsten Lobkowitz und der Frage nach der Selbständigkeit des Kaisers im Vergleich zu den Interessen seiner Berater.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Fürst Wenzel Eusebius Lobkowitz?
Lobkowitz war Obersthofmeister und engster Berater von Kaiser Leopold I. und prägte zeitweise eine pro-französische Politik des Hauses Habsburg.
Welchen Einfluss hatte Lobkowitz auf Kaiser Leopold I.?
Die Arbeit untersucht, ob Lobkowitz den Kaiser wie eine "Statue" dirigierte oder ob er lediglich ein Werkzeug der kaiserlichen Politik war.
Was führte zum Sturz von Lobkowitz?
Sein Fall war eng mit politischen Umschwüngen, der Rivalität zum Haus Auersperg und Hofintrigen verknüpft, die schließlich zu seiner Verbannung aus Wien führten.
Was versteht man unter der „höfischen Gesellschaft“ in diesem Kontext?
In Anlehnung an Norbert Elias wird der Hof als Ort informeller Machtverteilung analysiert, an dem die Aristokratie durch Nähe zum Herrscher politischen Einfluss gewinnt.
War Lobkowitz ein Anhänger Frankreichs?
Ja, unter seinem Einfluss näherte sich Österreich zeitweise dem Sonnenkönig Ludwig XIV. an, was im Gegensatz zur traditionellen habsburgischen Politik stand.
- Arbeit zitieren
- Geoffrey Schöning (Autor:in), 2000, Aufstieg und Fall des Fürsten Lobkowitz - Die Biographie eines Günstlingsministers, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/3148