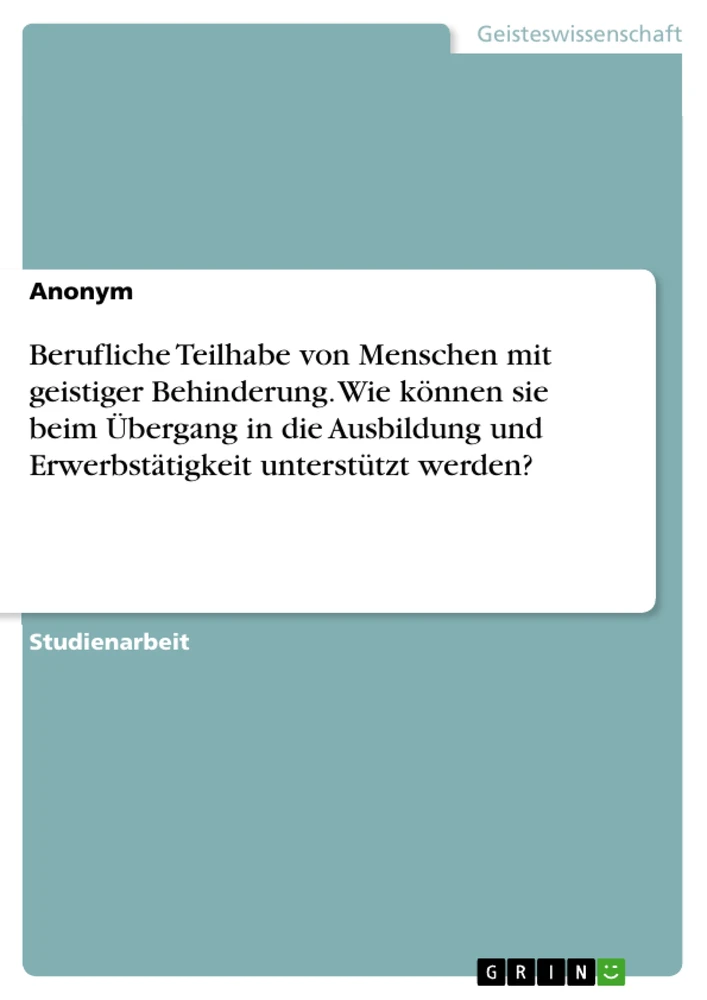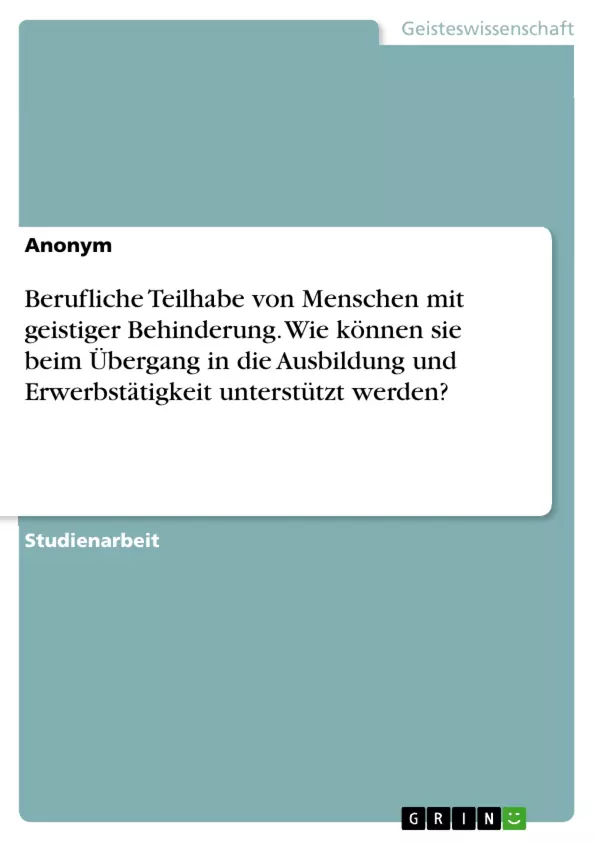Menschen mit Behinderung haben in der Bundesrepublik Deutschland die grundsätzlich grundrechtlich garantierte Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die frei gewählt oder angenommen wird. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Trotzdem wird nur ein verschwindend geringer Teil der Absolventen einer Förderschule für geistige Entwicklung tatsächlich auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert. Vielmehr besuchen die meisten nach dem Abschluss der Förderschule eine Maßnahme des Übergangssystems, wie z.B. das schulische Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder den Berufsbildungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), um dann in der Regel nach der 2 jährigen Eingangsphase nahtlos in den Arbeitsbereich der Werkstätten zu wechseln, wo sie in der Regel auch verbleiben.
In dieser Arbeit wird der Übergang von der Förderschule für Menschen mit einer geistigen Behinderung in das Erwerbsleben näher betrachtet. Hierbei liegt der Fokus auf den Bemühungen, eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang soll folgender Fragestellung nachgegangen werden: „Welche Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe gibt es für Menschen mit geistiger Behinderung und wie können diese beim Übergang in Ausbildung und Erwerbstätigkeit unterstützt werden?“
Der erste Teil dieser Arbeit wird sich auf den ersten Teil der Fragestellung beziehen und die Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe für Menschen mit einer geistigen Behinderung aufzeigen. Hierbei soll sowohl auf den „klassischen“ Weg der Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, wie auch auf alternative Formen – wie etwa die berufliche Integration mit Hilfe einer Arbeitsassistenz, welcher im zweiten Teil vorgestellt wird eingegangen werden. Weiterhin beschäftigt sich der zweite Teil dieser Arbeit mit den Unterstützungsmöglichkeiten, die beim Übergang von der Schule in den Beruf greifen. In dem letzten Teil der Arbeit werden die erworbenen Erkenntnisse zusammengetragen und mögliche Visionen durchdacht, welche von einer Integration in den Arbeitsmarkt hin zu einer Inklusiven Arbeitswelt führen soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung
- 3. Übergänge von der Schule auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
- 3.1 Heranführung an den Arbeitsmarkt
- 3.2 Unterstützung und Vernetzung verschiedenster Akteure im Übergang von Schule - Beruf
- 3.3 Berufliche Integration von Menschen mit einer geistigen Behinderung durch Arbeitsassistenz
- 4. Ausblick und Visionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Übergang von der Förderschule für Menschen mit geistiger Behinderung in das Erwerbsleben, mit dem Fokus auf der Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Die zentrale Fragestellung lautet: Welche Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe gibt es für Menschen mit geistiger Behinderung und wie können diese beim Übergang in Ausbildung und Erwerbstätigkeit unterstützt werden?
- Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung
- Unterstützungsmöglichkeiten beim Übergang Schule-Beruf
- Alternativen zur Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
- Herausforderungen bei der Integration in den ersten Arbeitsmarkt
- Visionen einer inklusiven Arbeitswelt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Übergangs von der Förderschule für Menschen mit geistiger Behinderung in das Berufsleben ein. Sie stellt die rechtliche Grundlage der Gleichberechtigung heraus und hebt gleichzeitig den geringen Anteil an Absolventen von Förderschulen, die tatsächlich in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden, hervor. Die Arbeit fokussiert sich auf die Möglichkeiten der Integration und die damit verbundenen Unterstützungsmöglichkeiten.
2. Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Wege der beruflichen Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung. Es werden sowohl der klassische Weg der Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) als auch alternative Formen, wie die Integration mit Arbeitsassistenz, diskutiert. Die Bedeutung von Arbeit für die persönliche Entwicklung und soziale Teilhabe wird hervorgehoben, wobei die Herausforderungen aufgrund fehlender anerkannter Schulabschlüsse betont werden. Das Kapitel beschreibt verschiedene Ausbildungsoptionen, darunter reguläre und abgestufte Ausbildungen, F-Lehrgänge und die Rolle der WfbM als qualifizierender und vermittelnder Ort.
3. Übergänge von der Schule auf den allgemeinen Arbeitsmarkt: Dieses Kapitel befasst sich mit den Unterstützungsmöglichkeiten beim Übergang von der Schule in den Beruf. Es werden verschiedene Strategien und Akteure beschrieben, die an diesem Übergang beteiligt sind, und die Bedeutung von Arbeitsassistenz für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt wird hervorgehoben. Die verschiedenen Ansätze werden im Kontext des Gesamtprozesses der beruflichen Integration beleuchtet, und die Notwendigkeit einer umfassenden und individuellen Unterstützung wird verdeutlicht. Die Kapitelteile greifen die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Möglichkeiten auf und zeigen die jeweiligen Unterstützungsstrukturen beim Übergang von der Schule in die Praxis auf.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Berufliche Teilhabe, Inklusion, Arbeitsmarktintegration, Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), Arbeitsassistenz, Übergang Schule-Beruf, Ausbildung, Integration, Teilhabe am Arbeitsleben, SGB IX.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Übergang von der Förderschule in den Beruf für Menschen mit geistiger Behinderung
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem Übergang von der Förderschule für Menschen mit geistiger Behinderung in das Berufsleben. Schwerpunkte sind die Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe, die Unterstützung beim Übergang Schule-Beruf, Alternativen zur Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), Herausforderungen der Integration in den ersten Arbeitsmarkt und Visionen einer inklusiven Arbeitswelt. Die zentrale Frage lautet: Welche Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe gibt es für Menschen mit geistiger Behinderung und wie können diese beim Übergang in Ausbildung und Erwerbstätigkeit unterstützt werden?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe, ein Kapitel zum Übergang Schule-Arbeit und einen Ausblick. Das Kapitel zum Übergang Schule-Arbeit unterteilt sich weiter in die Heranführung an den Arbeitsmarkt, die Unterstützung und Vernetzung verschiedener Akteure und die berufliche Integration durch Arbeitsassistenz.
Welche Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Wege der beruflichen Teilhabe, darunter die Beschäftigung in einer WfbM, die Integration in den ersten Arbeitsmarkt mit Arbeitsassistenz, reguläre und abgestufte Ausbildungen sowie F-Lehrgänge. Die Bedeutung von Arbeit für die persönliche Entwicklung und soziale Teilhabe wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)?
Die WfbM wird als eine Möglichkeit der beruflichen Teilhabe dargestellt, aber auch alternative Wege werden beleuchtet. Die Arbeit diskutiert die WfbM sowohl als klassischen Beschäftigungsort als auch als qualifizierenden und vermittelnden Ort für den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt.
Welche Unterstützungsmöglichkeiten beim Übergang Schule-Beruf werden genannt?
Das Dokument beschreibt verschiedene Strategien und Akteure, die am Übergang Schule-Beruf beteiligt sind, und hebt die Bedeutung der Arbeitsassistenz für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt hervor. Die Notwendigkeit einer umfassenden und individuellen Unterstützung wird betont.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktintegration angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen, die sich aus fehlenden anerkannten Schulabschlüssen ergeben und die Notwendigkeit einer umfassenden Unterstützung beim Übergang in den ersten Arbeitsmarkt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, Berufliche Teilhabe, Inklusion, Arbeitsmarktintegration, Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), Arbeitsassistenz, Übergang Schule-Beruf, Ausbildung, Integration, Teilhabe am Arbeitsleben, SGB IX.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Übergang von der Förderschule für Menschen mit geistiger Behinderung in das Erwerbsleben und konzentriert sich auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Sie zielt darauf ab, Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe und Unterstützungsmöglichkeiten beim Übergang Schule-Beruf aufzuzeigen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Berufliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung. Wie können sie beim Übergang in die Ausbildung und Erwerbstätigkeit unterstützt werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/314647