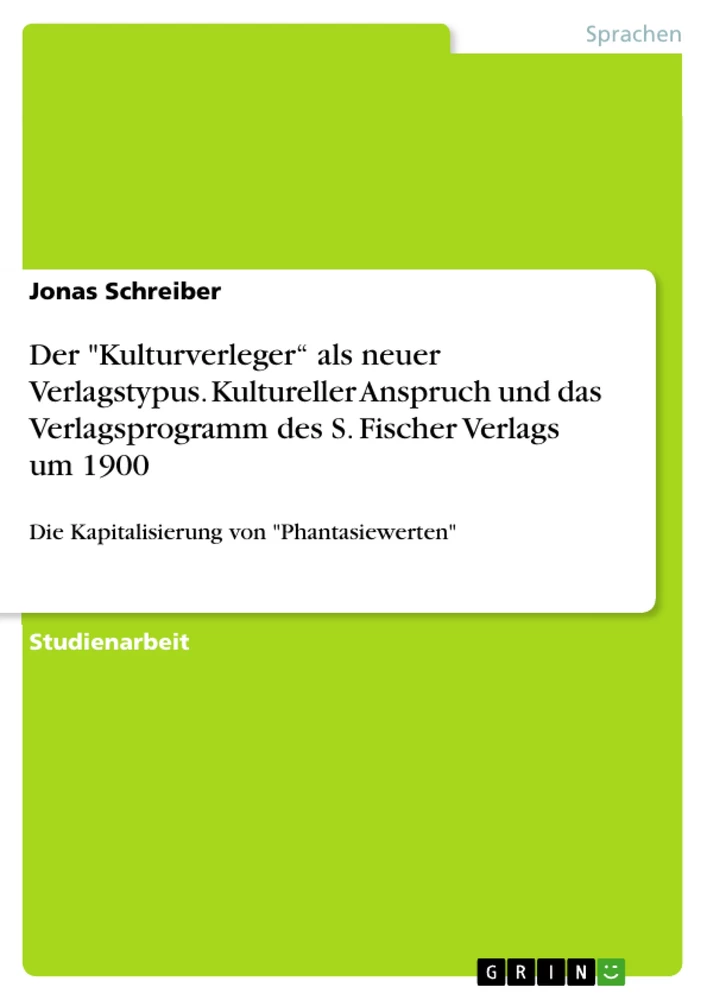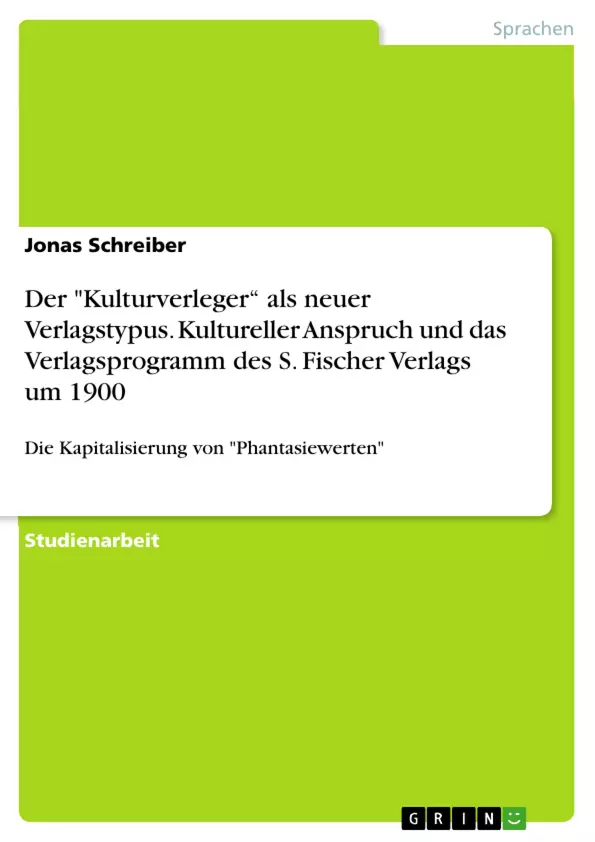Über die „Kulturverleger“ als neuer Verlagstypus um 1900 schreibt Wittmann, dass diese in besonderer Weise am Literaturbetrieb beteiligt waren: So pflegten sie sehr intensiv die Kontakte zu ihren Autoren und waren damit ein produktiver und wesentlicher Bestandteil des literarischen Lebens. Darüber hinaus wird den „Kulturverlegern“ sehr häufig zugeschrieben, dass sie bei ihrer Arbeit als ‚Literaturproduzenten‘ im weitesten Sinn zwei Bereiche miteinander vereinigen mussten, die es schwer zu vereinen gilt: den kulturell-ideellen und den wirtschaftlich-kommerziellen.
Ich werde mich nun in der folgenden Arbeit mit genau diesem Spannungsfeld in Bezug auf die Produktion kulturell–anspruchsvoller Literatur von „Kulturverlegern“ beschäftigen, zumal kulturell-wertvolle Literatur zumeist keinen wirtschaftlichen Erfolg verspricht. Freilich ist die Einteilung in kulturell-wertvoll und ökonomisch-erfolgreich äußerst fraglich, da diese Kategorien nicht wirklich klar definiert werden können. Dennoch werde ich herausarbeiten, welche Konzepte und Vorgehensweisen von solchen Verlegern angewandt wurden und inwiefern sich diese im jeweiligen Verlagsprofil zeigten – die besondere Doppelrolle des Akteurs „Kulturverleger“ auf dem literarischen Feld stellt hierfür die argumentative Grundlage dar.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Der Kulturverleger und die „Regeln der Kunst“
- Samuel Fischer und die „Phantasiewerte“
- Das Verlagsprofil des S. Fischer Verlags
- Das, geschlossene Verlagsprofil
- Fischers unkonventionelles erstes Programm
- Die Technologische Abteilung als Teil einer Mischkalkulation
- Sammlung, ganzer Autoren
- Gesamtausgaben als,repräsentative Zusammenfassung‘
- Klassikerinthronisation
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen kulturellem Anspruch und wirtschaftlichem Erfolg im Verlagsprogramm des S. Fischer Verlags um 1900, indem sie das Konzept des Kulturverlegers und seine Doppelrolle auf dem literarischen Feld analysiert.
- Der Begriff des,kulturellen Anspruchs' und seine Bedeutung für Samuel Fischer.
- Die spezifischen Merkmale des Verlagsprogramms des S. Fischer Verlags.
- Die Strategien und Methoden, die Fischer zur Vermarktung kulturell-anspruchsvoller Literatur einsetzte.
- Die Relevanz von,Phantasiewerten' für den kulturellen Anspruch des Verlags.
- Die Rolle des Kulturverlegers im Kontext des literarischen Feldes und seiner Akteure.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und skizziert den theoretischen Rahmen, der für die Analyse des Verlagsprogramms des S. Fischer Verlags verwendet wird.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Konzept des Kulturverlegers und beleuchtet seine Positionierung im literarischen Feld mithilfe der Feld-Theorie von Pierre Bourdieu.
- Das dritte Kapitel analysiert den Begriff,kultureller Anspruch' und zeigt, welche Ansprüche Samuel Fischer bei seiner Verlagsarbeit stellte.
- Das vierte Kapitel beleuchtet das Verlagsprofil des S. Fischer Verlags und untersucht verschiedene Aspekte des Programms, wie z. B. die Sammlung ganzer Autoren und die Herausgabe von Gesamtausgaben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit behandelt die Themenfelder Kulturverleger, Verlagsprofil, literarisches Feld, kultureller Anspruch, Phantasiewerte, Samuel Fischer, S. Fischer Verlag, Verlagsgeschichte, Literaturgeschichte, Bourdieu.
- Quote paper
- Jonas Schreiber (Author), 2014, Der "Kulturverleger“ als neuer Verlagstypus. Kultureller Anspruch und das Verlagsprogramm des S. Fischer Verlags um 1900, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/314232