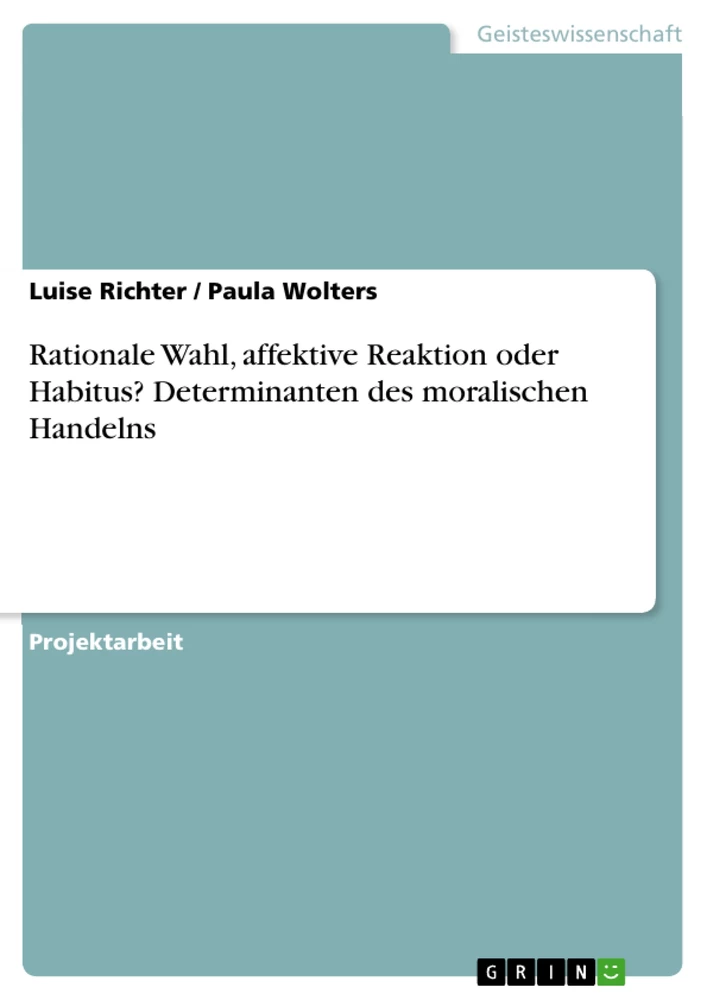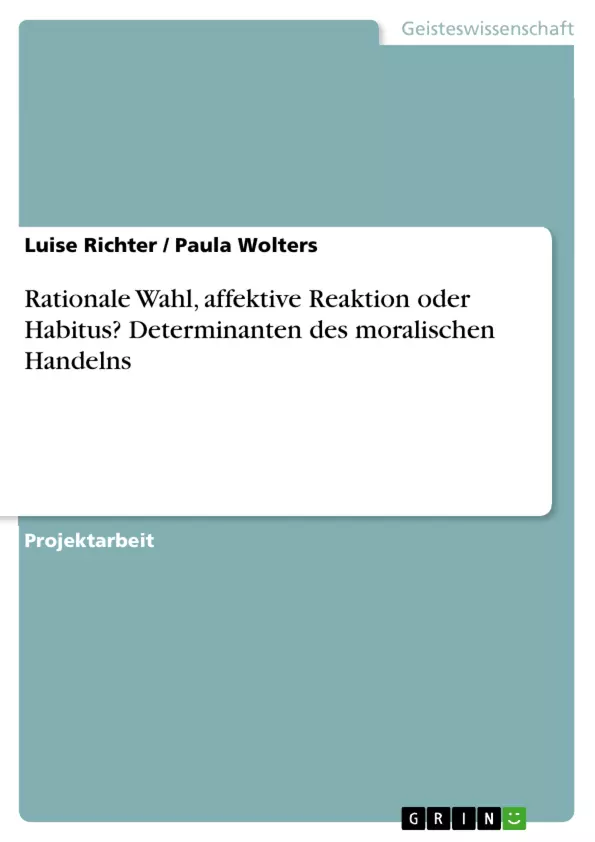"Das Richtige" zu tun stellt oftmals eine große Herausforderung dar. Nahezu täglich werden wir mit der Aufgabe konfrontiert, moralische Entscheidungen zu treffen. Nicht selten handelt es sich dabei um echte Dilemmata, bei denen uns keine Alternative als vollkommen positiv erscheint. Dennoch schaffen wir es immer wieder, Entscheidungen zu fällen und die Option zu wählen, von der wir, zumindest für den Moment, glauben, dass sie die beste ist.
Diese Entscheidungen werden durch eine Vielzahl von Determinanten beeinflusst. Neben den erlernten Werten, Normen und Moralvorstellungen, die in ihren Grundzügen relativ konstant sind, spielen insbesondere auch die Umstände in der konkreten Situation eine Rolle. Welche Faktoren führen dazu, dass wir uns in bestimmten Situationen moralisch bzw. nicht moralisch verhalten?
Handelt es sich bei moralischen Handlungen eher um rationale, emotionale oder habituelle Akte? Diese Fragen sollen in vorliegender Projektarbeit beantwortet werden. Im Fokus werden dabei die Faktoren stehen, die in konkreten Situationen von Bedeutung sind. Dazu gehören zum einen rationale Faktoren wie Kosten und Nutzen der Handlung und zum anderen eher emotionale oder affektive Elemente wie das Selbstbild des Entscheiders oder Merkmale anderer Personen, die durch die Entscheidung betroffen sind.
Zunächst werden wir auf Moral und deren Einflussfaktoren im Allgemeinen eingehen. Dabei werden wir grundlegende Definitionen vornehmen sowie die, an unserem Schwerpunkt angrenzenden, Themengebiete kurz umreisen, um dann genauer auf unsere konkrete Fragestellung eingehen zu können. Im darauffolgenden Abschnitt werden wir uns mit den zwei von Epstein unterschiedenen Informationsverarbeitungssystemen des Menschen befassen: das "rational system" und das "experiential system".
Danach werden wir auf verschiedene Theorien zur Erklärung moralischen Handelns eingehen. Dazu gehören sowohl Ansätze, die sich eher mit rationalem Handeln beschäftigen, also dem „rational system“ zuzuordnen sind, als auch Theorien, die sich auf Emotionen und habituelles Handeln beziehen und entsprechend dem „experiential system“ unterliegen. Die wichtigste Kategorie bilden allerdings die integrativen Ansätze, die daher auch etwas ausführlicher behandelt werden. Schließlich werden wir unsere Darstellungen anhand des Beispiels des Spendenverhaltens veranschaulichen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung (PW)
- 2. Grundannahmen zur Moral (PW)
- 3. Systeme der Informationsverarbeitung nach Epstein (PW)
- 4. Determinanten moralischer Entscheidungen
- 4.1 Psychologisch (LR)
- 4.1.1 Die Theorie der sozialmoralischen Landkarte der Subjekte (LR)
- 4.1.2 Der "Identified Victim Effect" (LR)
- 4.2 Habituell (LR)
- 4.3 Rational (PW)
- 4.4 Integrierende Ansätze
- 4.4.1 Das Modell der Frame-Selektion (PW)
- 4.4.2 Die Situational Action Theory (PW)
- 4.4.3 Das Paradox der moralischen Selbstregulation (LR)
- 4.4.4 Die Theorie der Wahrung des Selbstkonzepts (LR)
- 5. Das Beispiel des Spendenverhaltens (LR)
- 6. Fazit (LR und PW)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Projektarbeit befasst sich mit den Determinanten moralischen Handelns und untersucht die Faktoren, die in konkreten Situationen von Bedeutung sind, um moralische Entscheidungen zu treffen. Dabei werden rationale Faktoren wie Kosten-Nutzen-Abwägungen sowie emotionale Elemente wie das Selbstbild des Entscheiders und Merkmale der betroffenen Personen berücksichtigt.
- Grundannahmen zur Moral und deren Einflussfaktoren
- Die zwei Informationsverarbeitungssysteme des Menschen nach Epstein: "Rational System" und "Experiential System"
- Theorien zur Erklärung moralischen Handelns, einschließlich rationaler, emotionaler und habitueller Ansätze sowie integrierender Modelle
- Der Einfluss von Sozialisation und Erziehung auf die Entwicklung individueller Moral
- Das Beispiel des Spendenverhaltens als Illustration der Determinanten moralischen Handelns
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung (PW)
Diese Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Faktoren zu moralischem oder amoralischem Verhalten in konkreten Situationen führen. Es wird die Bedeutung von rationalen und emotionalen Determinanten für moralische Entscheidungen hervorgehoben.
- Kapitel 2: Grundannahmen zur Moral (PW)
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionen und Auslegungen des Moralbegriffs, wobei der Fokus auf die individuelle Moral liegt. Es werden auch Einflüsse wie Genetik, Sozialisation und gesellschaftliche Faktoren auf die individuelle Moral erwähnt, die aber nicht im Detail behandelt werden.
- Kapitel 3: Systeme der Informationsverarbeitung nach Epstein (PW)
Dieses Kapitel präsentiert die "Cognitive-Experiential Theory" von Seymour Epstein, die zwei Informationverarbeitungssysteme beim Menschen postuliert: das "experiential system" und das "rational system". Es werden die Funktionsweisen beider Systeme sowie deren Einfluss auf das Verhalten beschrieben.
- Kapitel 4: Determinanten moralischer Entscheidungen
In diesem Kapitel werden verschiedene Theorien zur Erklärung moralischer Entscheidungen vorgestellt, die sowohl rationale als auch emotionale und habituelle Faktoren berücksichtigen. Es werden verschiedene Modelle vorgestellt, die den Einfluss verschiedener Determinanten auf das moralische Verhalten in konkreten Situationen analysieren.
- Kapitel 5: Das Beispiel des Spendenverhaltens (LR)
Dieses Kapitel veranschaulicht die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Determinanten moralischen Handelns am Beispiel des Spendenverhaltens. Es werden wahrscheinlich verschiedene Faktoren beleuchtet, die das Entscheidungsverhalten von Personen bei Spenden beeinflussen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Moral, Determinanten moralischen Handelns, rationale Entscheidungen, emotionale Entscheidungen, habituelles Handeln, Informationsverarbeitungssysteme, "experiential system", "rational system", Theorie der sozialmoralischen Landkarte der Subjekte, "Identified Victim Effect", Frame-Selektion, Situational Action Theory, Selbstkonzepterhaltung, Spendenverhalten.
- Quote paper
- Luise Richter (Author), Paula Wolters (Author), 2015, Rationale Wahl, affektive Reaktion oder Habitus? Determinanten des moralischen Handelns, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/313478