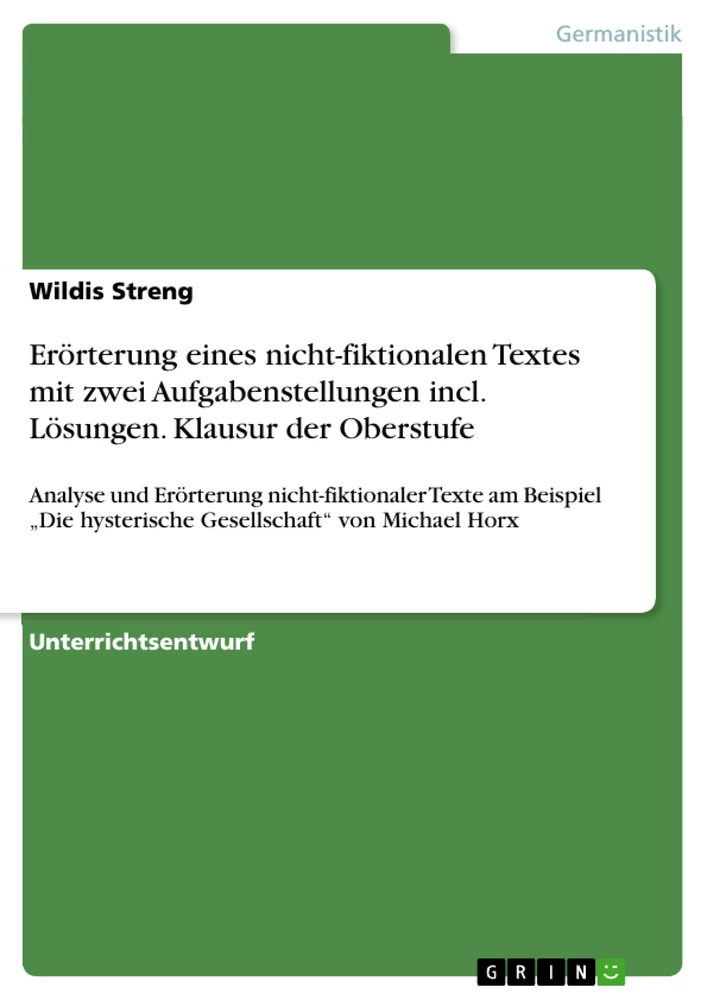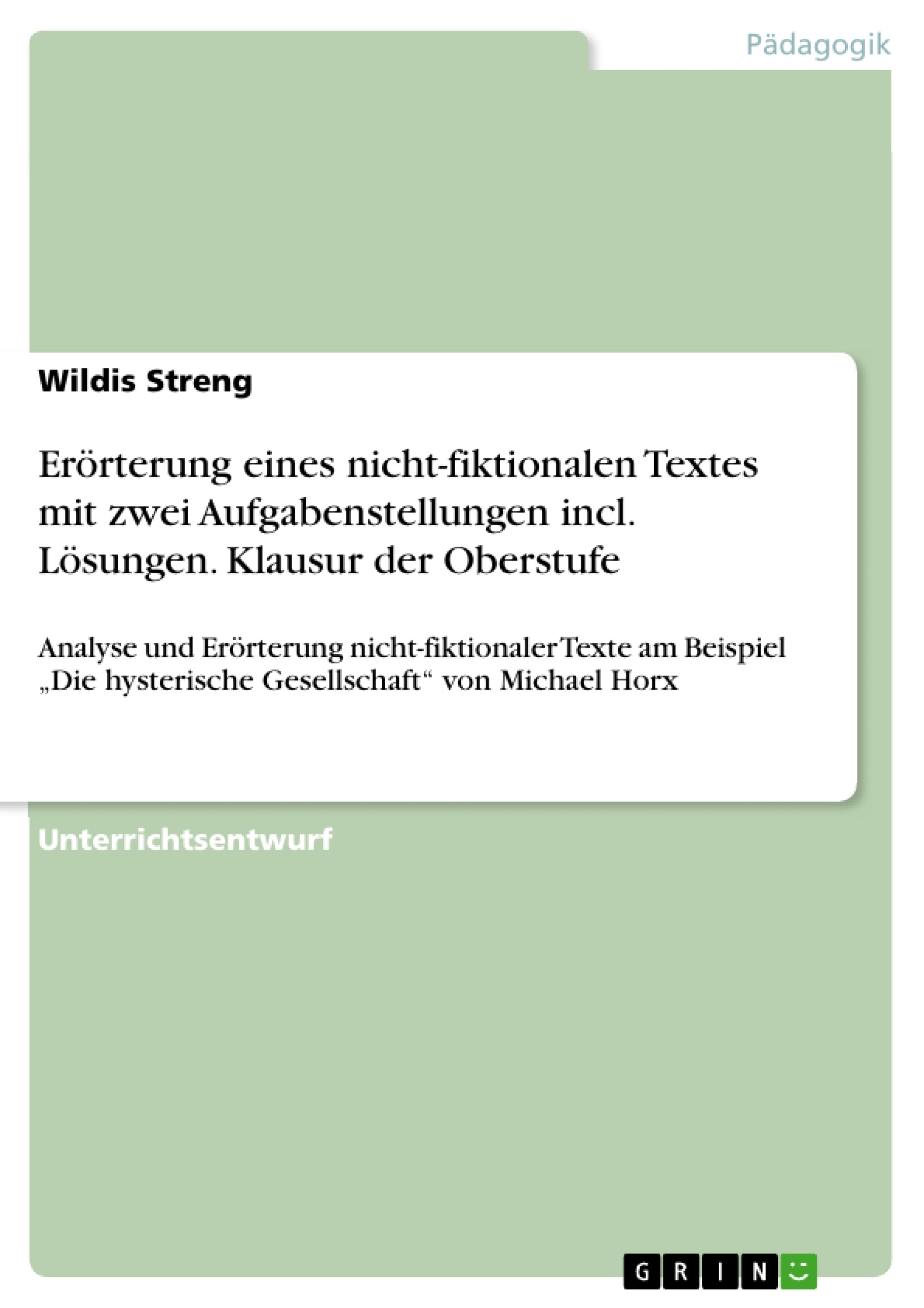Schwerpunktsetzungen auf der ersten und der zweiten Teilaufgabe, analog zu den Aufgabenstellungen des Deutsch-Abiturs.
In seinem am 07.07.2008 im Focus erschienenen Essay „Die Hysterische Gesellschaft“, der den Untertitel „Warum unsere apokalyptische Weinerlichkeit alles andere als harmlos ist“, trägt, mokiert sich Matthias Horx über die seiner Meinung nach hysterische, überängstliche Gesellschaft.
Horx beginnt mit der These, dass die Welt schlecht sei und immer schlechter werden würde. Dies sei zumindest die Meinung von „Experten“, die die Menschen durch die Medien beeinflussen würden. Er prägt den Terminus der „Angstparolen“ und liefert als Beispiel für eine solche angstmachende Parole die Verarmung. Anschließend bringt Horx eine EU-Definition von Armut an, welche er dahingehend kritisiert, dass sie nicht realistisch sei, da das Gehaltslevel, an dem die Armut gemessen würde, stetig im Steigen begriffen sei. Echte Armut resultiere daraus, dass unqualifizierte Arbeitskräfte weltweit Konkurrenz bekämen.
Horx fordert dazu auf, den Blick zu öffnen, das „ganze Bild zu begreifen“, wenn man an dieser Situation etwas ändern wolle – wenn. Weiterhin verweist Horx auf das vom frühen Menschen entwickelte „Alarmsystem Angst“, das in alten Zeiten vor Gefahr und Unbill bewahrt habe. Für Horx resultiert daraus allerdings auch im Zuge der Evolution eine Überempfindlichkeit, gleichsam eine Angst-Hysterie.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Textgebundene Erörterung zu einem Essay – eine Klausur mit zwei Aufgabenstellungen und Lösungsaufsätzen
- Analyse und Erörterung Nicht-fiktionaler Texte am Beispiel „Die hysterische Gesellschaft“ von Michael Horx
- Arbeiten Sie die Kerngedanken des Textes heraus und analysieren Sie seine strukturelle und sprachliche Gestaltung.
- Setzen Sie sich mit dem von Horx beschriebenen Phänomen des „Kristotainment“ auseinander!
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der Essay "Die hysterische Gesellschaft" von Matthias Horx analysiert die Überängstlichkeit der heutigen Gesellschaft und kritisiert den Trend zur "Krisenunterhaltung". Der Autor argumentiert, dass die Medien durch reißerische Berichterstattung über vermeintliche Bedrohungen eine "Angst-Hysterie" schüren und den Blick für reale Probleme verstellen.
- Kritik an der "Angst-Hysterie" der Gesellschaft
- Analyse der Medienlandschaft und ihrer Rolle im "Krisotainment"
- Die Bedeutung von nüchterner Analyse und Vernunft im Umgang mit gesellschaftlichen Problemen
- Das Problem der "Voyeurismus" in Bezug auf weltweite Krisen
- Die Notwendigkeit, zwischen tatsächlichen Gefahren und reißerischer Berichterstattung zu unterscheiden
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der Text analysiert zunächst die Kernaussagen von Horx' Essay, in dem er die Verbreitung von Angst durch "Angstparolen" in den Medien kritisiert. Horx stellt die "EU-Definition von Armut" in Frage und betont die Notwendigkeit, das "ganze Bild" zu betrachten, um Lösungen zu finden. Anschließend erläutert Horx die Entstehung des "Alarmsystems Angst" in der Menschheitsgeschichte und kritisiert die "Überritualisierung von Angst" bei den Maya. Als Gegenbeispiel wird Finnland genannt, das mit einer Krise nüchtern und analytisch umgegangen ist. Horx prägt den Begriff "Krisotainment" und kritisiert die voyeuristische Berichterstattung über Katastrophen in den Medien. Der Autor mahnt zu Vernunft und Nüchternheit im Umgang mit Gefahren und plädiert für einen "erwachsenen" Diskurs über relevante Themen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe des Textes sind "Angst-Hysterie", "Krisotainment", "Angstparolen", "Voyeurismus", "Nüchternheit", "Vernunft", "Medienlandschaft", "Gefahrendiskurs", "Erwachsen" und "Realität".
- Quote paper
- Wildis Streng (Author), 2015, Erörterung eines nicht-fiktionalen Textes mit zwei Aufgabenstellungen incl. Lösungen. Klausur der Oberstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/313436