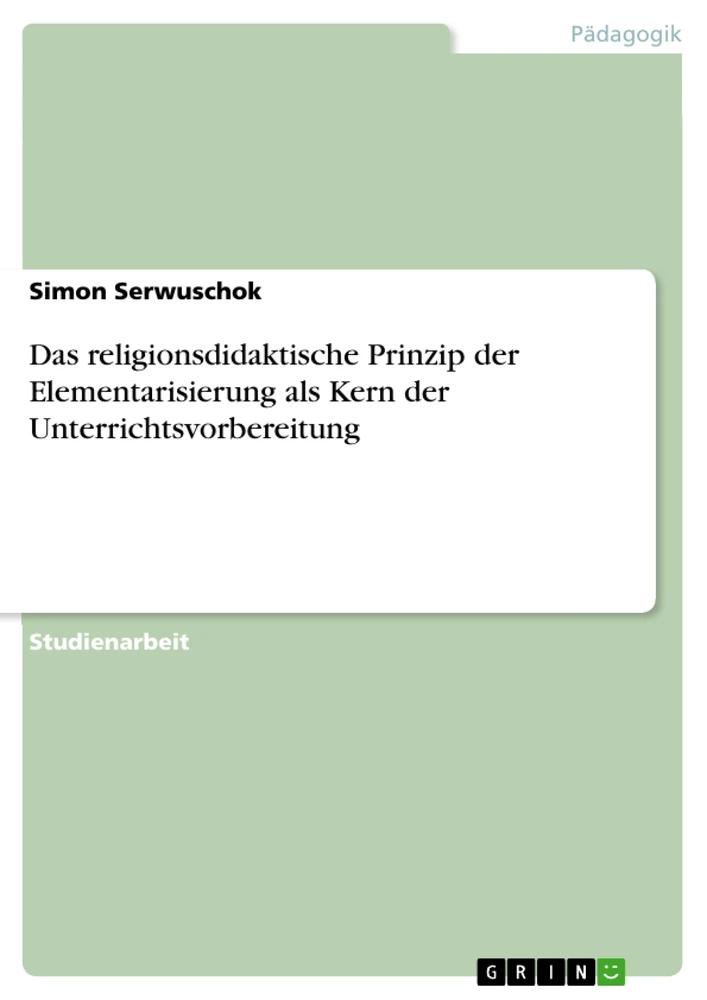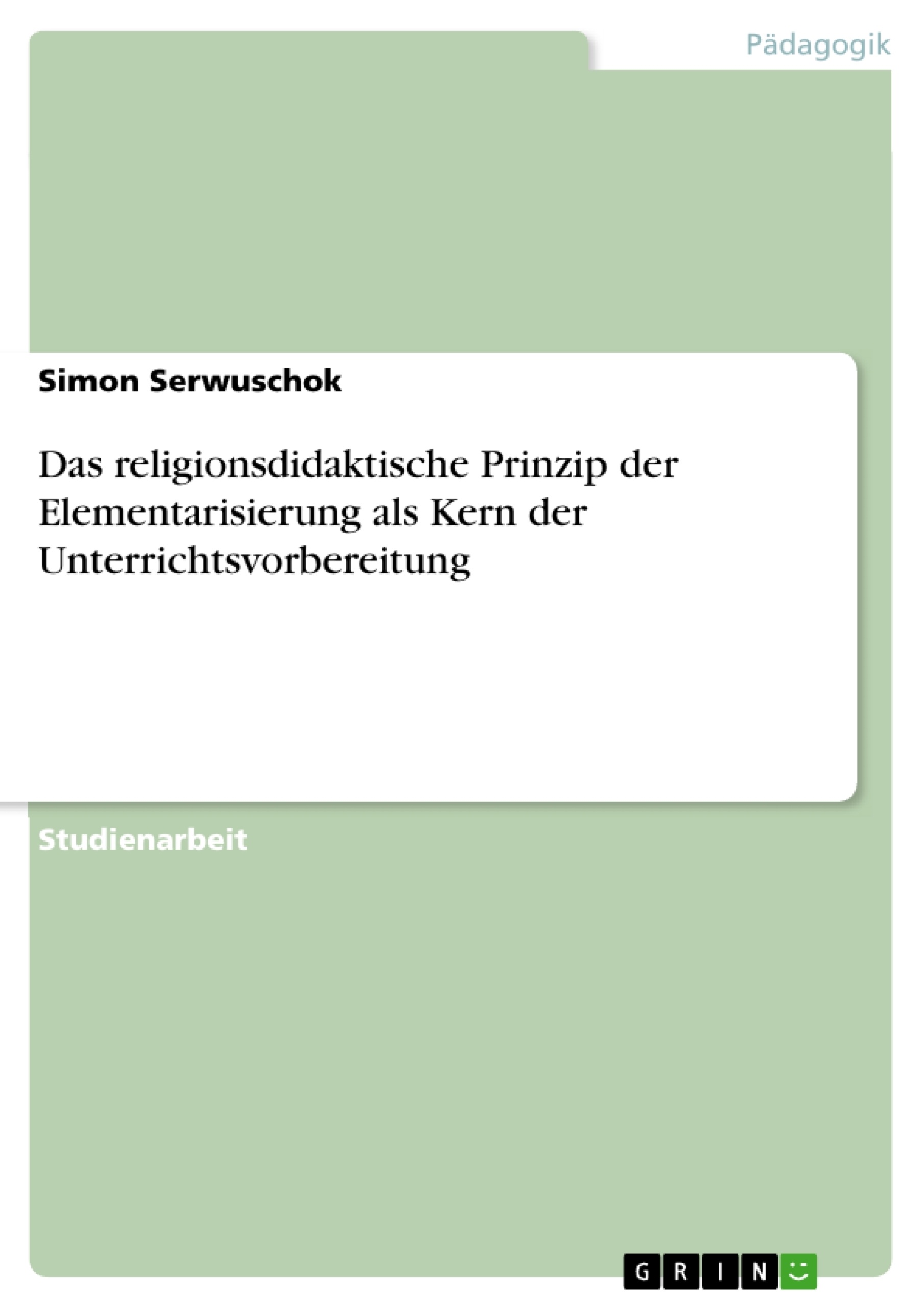Die folgende Arbeit konzentriert sich auf das Elementarisierungskonzept und soll in einer deduktiven Vorgehensweise erfolgen, indem in einem ersten Schritt zu-nächst der Begriff der Elementarisierung allgemein geklärt werden soll, um an-schließend eine didaktische Definition des Begriffs aufzustellen. Danach soll das religionsdidaktische Prinzip der Elementarisierung nach Friedrich Schweitzer und Karl Ernst Nipkow vorgestellt werden, wobei der Fokus sowohl auf die Intention und Genese, als auch auf die fünf Dimensionen des Modells gesetzt werden soll. Im weiteren Verlauf soll das erste der fünf Elemente, die sogenannten „elementaren Strukturen“ am Beispiel des Gleichnisses von den Arbeiten im Weinberg aus Mt 20, 1-16 veranschaulicht werden. In einem letzten Schritt sollen die gesammelten Ergebnisse in einem abschließenden Fazit zusammengeführt und kritisch beleuchtet werden.
Zu Beginn der 1970er Jahre war es unausweichlich, „welch Trümmerfeld ungeordneter, falscher und existentiell völlig bedeutungsloser biblisch-christlicher Überlieferungselemente“ bei den Schülerinnen und Schülern vorzufinden war.
Diese Einsicht veranlasste die Religionspädagogen sich auf die elementaren Anfangsprobleme zurückzuberufen, um sich bei theologischen Inhalten auf das Grundlegende zu konzentrieren. Dabei ging insbesondere Karl Ernst Nipkow dem Problem nach, wie in einem Unterrichtsvorgang des Lehr- und Lernbarem als Beziehungsgeschehen zwischen den Lernenden, dem Lehrer und der Sache elementare Strukturen, elementare Erfahrungen, elementare Anfänge und elementare Wahrheiten zum Ausdruck kommen könnten. Daraufhin entwickelte Nipkow das Tübinger Modell der Elementarisierung, das primär für die Vorbereitung und Gestaltung von Religionsunterricht angesehen werden kann und bei den religionsunterrichtlichen Themen stärker darauf abzielen sollte, Aspekte aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen in den Unterricht mit einzubeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klärung und Definition des Begriffs der Elementarisierung
- Das Modell der Elementarisierung nach Nipkow und Schweitzer
- Intention und Genese des Modells
- Die fünf Dimensionen des Modells
- Elementare Strukturen
- Elementare Erfahrungen
- Elementare Zugänge
- Elementare Wahrheiten
- Elementare Lernwege
- Elementare Strukturen zu Mt 20, 1 - 16
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem religionsdidaktischen Prinzip der Elementarisierung als Kern der Unterrichtsvorbereitung. Sie analysiert das Konzept der Elementarisierung und stellt die fünf Dimensionen des Modells von Nipkow und Schweitzer vor, die dazu beitragen, den Zugang zu religiösen Inhalten für Schülerinnen und Schüler zu vereinfachen und zu erschließen. Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Elementarisierung im Religionsunterricht, die sich aus den Bedürfnissen der Lernenden und der Komplexität des Unterrichtsstoffes ergibt.
- Klärung und Definition des Begriffs der Elementarisierung
- Das Modell der Elementarisierung nach Nipkow und Schweitzer
- Die fünf Dimensionen des Modells
- Anwendung des Modells in der Unterrichtspraxis
- Kritische Reflexion und Bewertung des Elementarisierungskonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung des Religionsunterrichts vor und beleuchtet die Notwendigkeit eines didaktischen Ansatzes, der die Begegnung zwischen den Lernenden und den Inhalten des Unterrichts ermöglicht. Kapitel 2 klärt den Begriff der Elementarisierung und untersucht seine allgemeine Bedeutung sowie seine Bedeutung im didaktischen Kontext. Kapitel 3 stellt das Modell der Elementarisierung von Nipkow und Schweitzer vor, wobei die Intention und Genese des Modells sowie die fünf Dimensionen, die elementaren Strukturen, Erfahrungen, Zugänge, Wahrheiten und Lernwege, erläutert werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Begriffe der Elementarisierung und des religionspädagogischen Prinzips der Elementarisierung. Dabei werden Themen wie die Vereinfachung und Erschließung von komplexen Inhalten im Religionsunterricht, das didaktische Vorgehen, die fünf Dimensionen des Modells von Nipkow und Schweitzer, sowie die Bedeutung der Elementarisierung für die Unterrichtsvorbereitung und -gestaltung behandelt. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tiefes Verständnis des Konzepts der Elementarisierung im Rahmen des Religionsunterrichts zu vermitteln und gleichzeitig einen praktischen Bezug zu den Anforderungen der Unterrichtspraxis herzustellen.
- Quote paper
- Simon Serwuschok (Author), 2014, Das religionsdidaktische Prinzip der Elementarisierung als Kern der Unterrichtsvorbereitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/311167