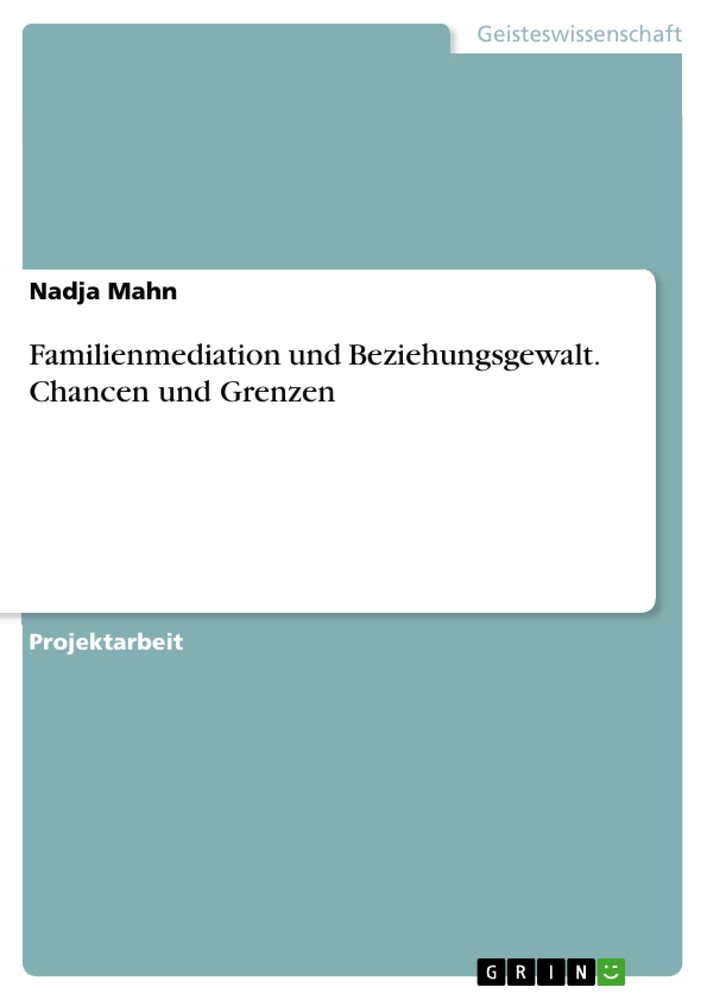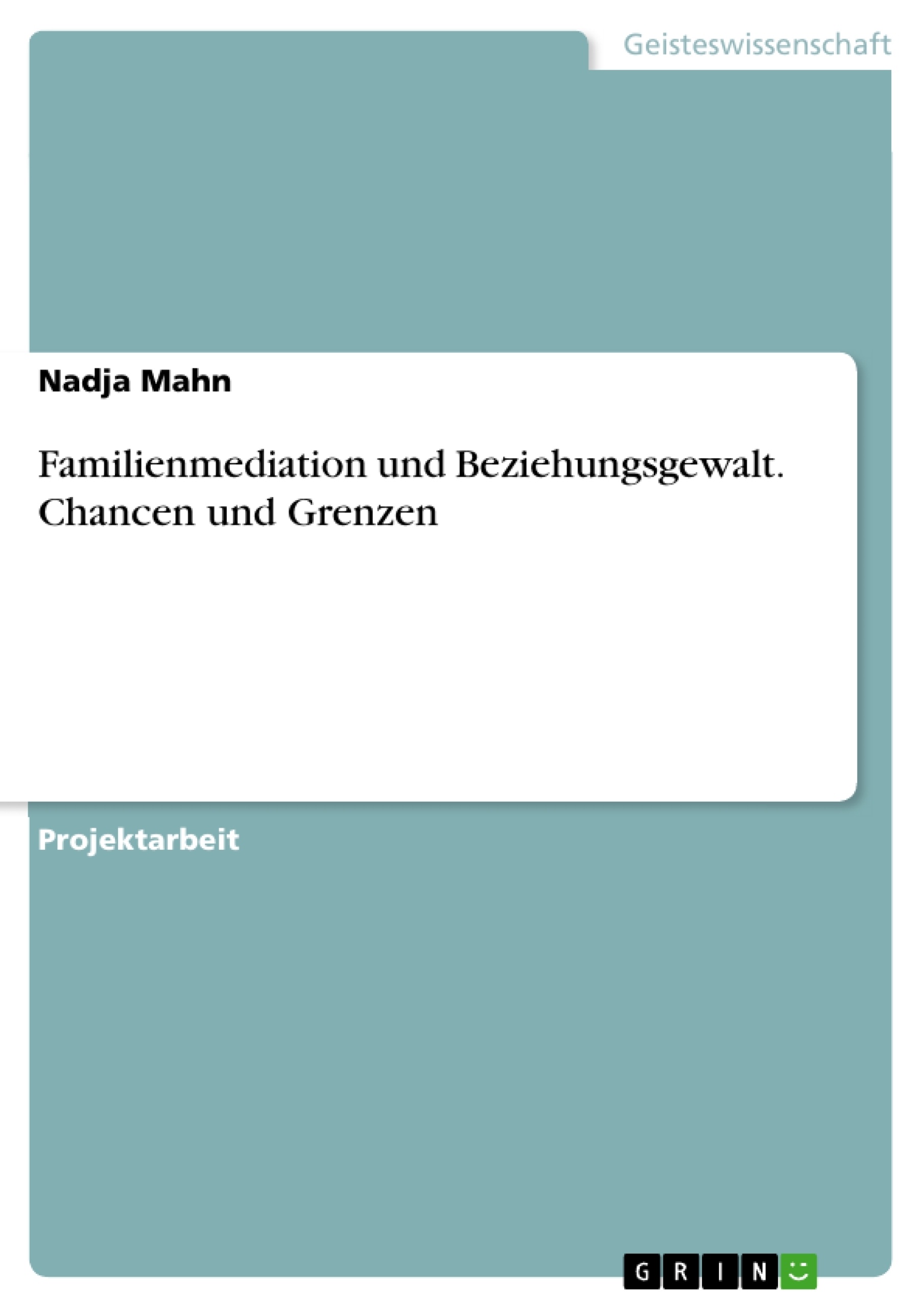Intention dieser Arbeit ist es, eine besondere Aufmerksamkeit für das Thema Familien- und Beziehungsgewalt zu
gewinnen und einen genaueren Blick auf die unterschiedlichen Formen und Dynamiken von Gewalt zu fördern. Darüber hinaus sollen Aussagen getroffen werden, ob und in welcher Form eine Mediation sinnvoll für Paare ist, bei denen ein Gewalthintergrund zu vermuten ist.
Im ersten Teil soll die Thematik Gewalt innerhalb einer Partnerschaft in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (körperlich, sexuell, psychisch und deren fließende Übergänge) dargestellt werden. Weiterhin werden die Gewaltdynamik, Entstehung und Gewaltverläufe beleuchtet und die Auswirkungen auf die Opfer sowie Täter dargestellt. Es folgt eine kurze Zwischenbilanz, die auf den zweiten Abschnitt dieser Arbeit heranführt.
Der zweite Teil befasst sich intensiv mit den Fragen, weshalb die Auseinandersetzung mit dem Thema Beziehungsgewalt für Mediatoren und Mediatorinnen von großer Bedeutung ist, inwiefern Mediation als Interventionsmöglichkeit zur Konfliktbewältigung vor dem Hintergrund Gewalt zwischen den Medianden tragbar ist und unter welchen Aspekten Mediation an Grenzen gelangt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Problemaufriss und zentrale Fragestellungen
- Begriffsannäherung Beziehungsgewalt
- Statistische Erhebungen zu Opfer-Täter-Zahlen
- Erscheinungsformen von Beziehungsgewalt
- (Aus-)Wirkungen von Beziehungsgewalt
- Gewaltverläufe in Paarbeziehungen
- Verhaltensmuster der Opfer
- Auswirkungen auf die Opfer
- Auswirkungen auf die Täter
- Erklärungsmodelle für die Ursachen von Beziehungsgewalt
- Zwischenresümee: Schlussfolgerungen für den Mediationskontext
- Einsatzfähigkeit von Familienmediation im
Kontext von Beziehungsgewalt
- Risiken und Grenzen der Mediation vor einem Gewalthintergrund
- Chancen von Familienmediation vor einem Gewalthintergrund
- Ausblick und Fazit für die Eignung von Familienmediation bei Beziehungsgewalt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Problematik von Beziehungsgewalt und untersucht die Eignung von Familienmediation im Kontext von Gewalt in Paarbeziehungen. Die zentrale Fragestellung ist, ob und unter welchen Bedingungen Mediation für Paare mit einem Gewalthintergrund sinnvoll eingesetzt werden kann.
- Definition und Erscheinungsformen von Beziehungsgewalt
- Statistische Erhebungen und Auswirkungen von Beziehungsgewalt auf Opfer und Täter
- Erklärungsmodelle für die Ursachen von Beziehungsgewalt
- Risiken und Chancen von Familienmediation im Kontext von Beziehungsgewalt
- Eignung von Familienmediation bei Beziehungsgewalt
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel stellt die Problematik von Beziehungsgewalt in den Mittelpunkt und beleuchtet die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Es wird auf die historische Entwicklung und die gesellschaftliche Tabuisierung von Gewalt in Paarbeziehungen eingegangen.
Das zweite Kapitel widmet sich der Definition von Beziehungsgewalt und betrachtet die verschiedenen Erscheinungsformen, wie körperliche, sexuelle und psychische Gewalt. Die Komplexität der Definition und die Abhängigkeit von kulturellen und gesellschaftlichen Werten werden diskutiert.
Das dritte Kapitel präsentiert statistische Erhebungen zu den Täter-Opfer-Zahlen, wobei der Fokus auf Gewalt gegenüber Frauen liegt. Die Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2004 liefert wichtige Erkenntnisse über die Häufigkeit und die verschiedenen Formen von Gewalt in Paarbeziehungen.
Das vierte Kapitel beleuchtet die (Aus-)Wirkungen von Beziehungsgewalt und geht auf Gewaltverläufe, Verhaltensmuster der Opfer und die Auswirkungen auf Opfer und Täter ein.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit Erklärungsmodellen für die Ursachen von Beziehungsgewalt. Es werden verschiedene Theorien und Ansätze vorgestellt, die versuchen, die Entstehung von Gewalt in Paarbeziehungen zu erklären.
Das sechste Kapitel fasst die Ergebnisse des ersten Teils zusammen und leitet zum zweiten Teil der Arbeit über, der sich mit den Chancen und Risiken von Familienmediation im Kontext von Beziehungsgewalt auseinandersetzt.
Das siebte Kapitel untersucht die Einsatzfähigkeit von Familienmediation bei Beziehungsgewalt. Es werden die Risiken und Grenzen der Mediation vor einem Gewalthintergrund betrachtet.
Das achte Kapitel befasst sich mit den Chancen von Familienmediation vor einem Gewalthintergrund und zeigt die möglichen Vorteile des Verfahrens für die Konfliktbewältigung in Paarbeziehungen mit einem Gewalthintergrund auf.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit widmet sich dem Thema Beziehungsgewalt, Familienmediation, Konfliktbewältigung, Gewaltverläufe, Opfer-Täter-Dynamik, Risikoabschätzung, Intervention, und die Eignung von Mediation bei Beziehungsgewalt.
Häufig gestellte Fragen
Ist Familienmediation bei Beziehungsgewalt sinnvoll?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und wägt ab, ob Mediation zur Konfliktbewältigung tragbar ist oder ob die Gewaltgeschichte das Verfahren unmöglich macht.
Welche Formen von Beziehungsgewalt werden unterschieden?
Es wird zwischen körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt unterschieden, wobei die Übergänge oft fließend sind.
Was sind die Risiken einer Mediation in Gewaltkontexten?
Zu den Risiken gehören die Gefährdung des Opfers, Machtungleichgewichte und die Unfähigkeit, auf Augenhöhe zu verhandeln.
Wie wirken sich Gewaltdynamiken auf Opfer und Täter aus?
Die Arbeit beleuchtet spezifische Verhaltensmuster von Opfern und die psychischen Folgen der Gewaltverläufe für beide Beteiligten.
Gibt es Chancen für Mediation trotz Gewalthintergrund?
Ja, unter bestimmten strengen Voraussetzungen kann Mediation helfen, Konflikte zu klären, sofern die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet ist.
- Arbeit zitieren
- Nadja Mahn (Autor:in), 2015, Familienmediation und Beziehungsgewalt. Chancen und Grenzen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/309662