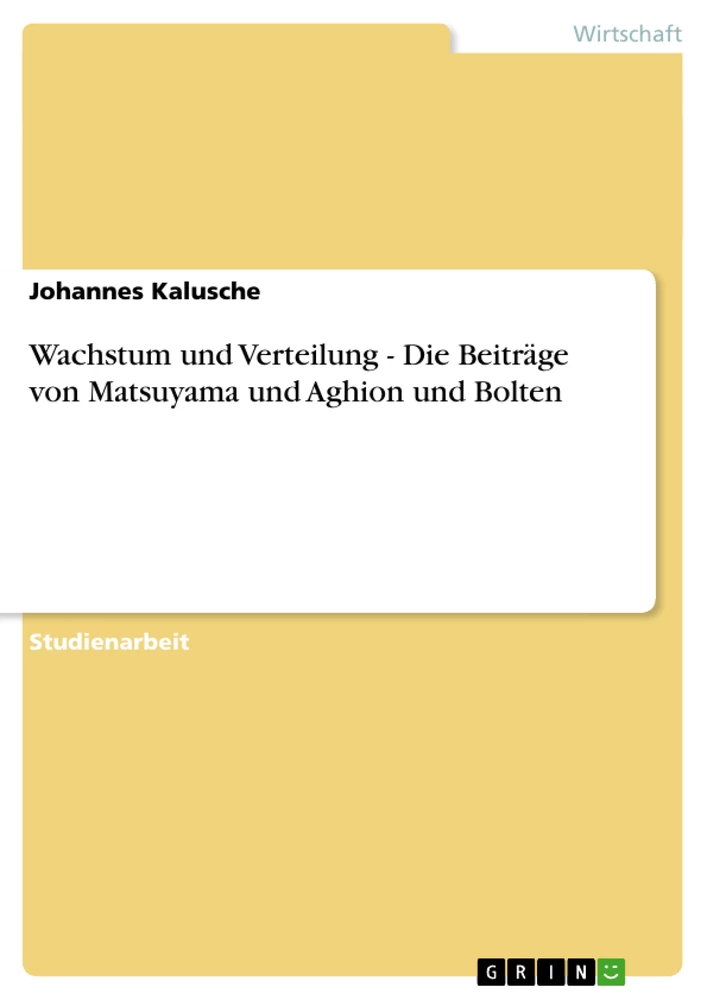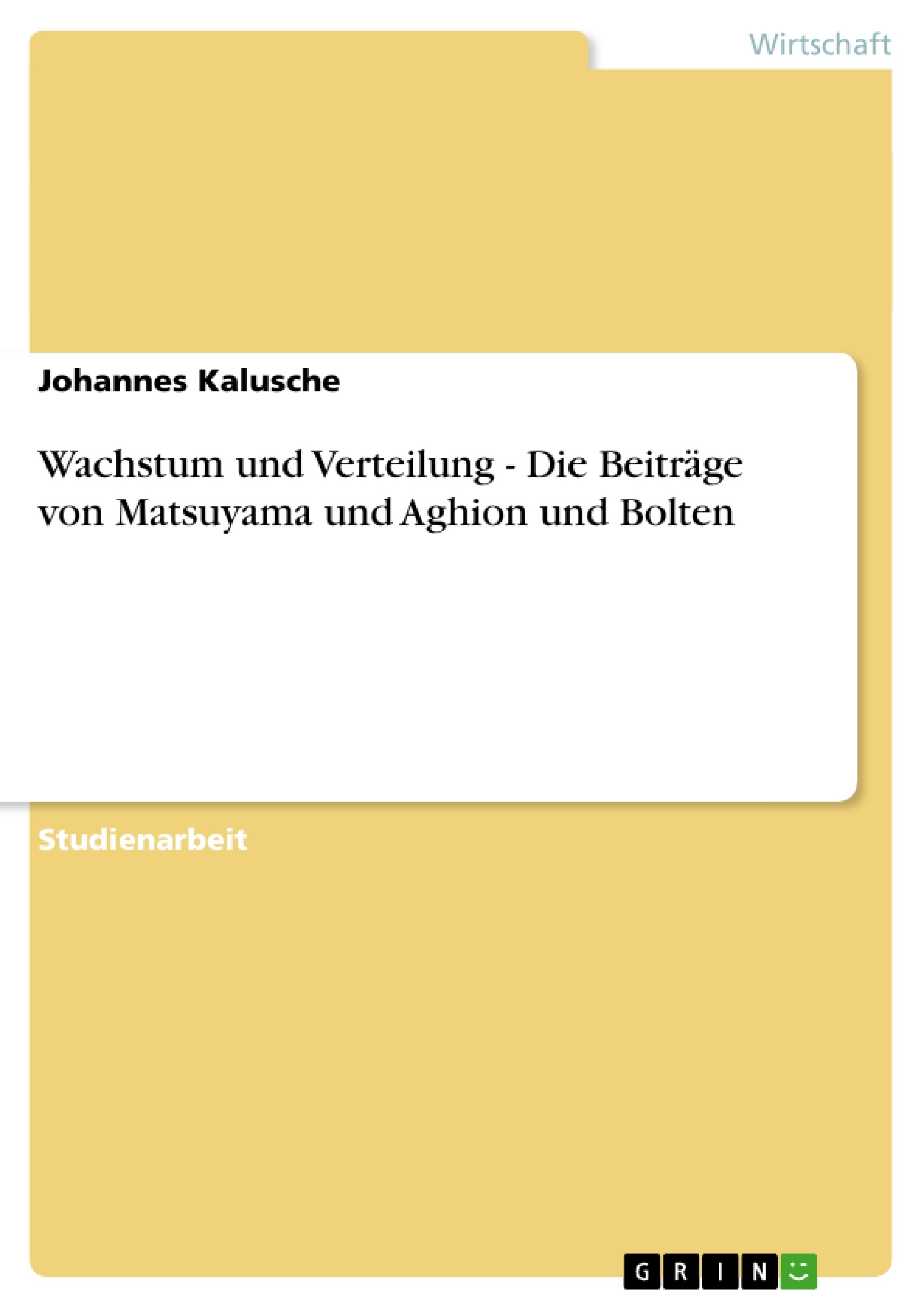Eine der Grundfragen an die Wirtschaftswissenschaft ist die, wie die täglich zu beobachtenden Unterschiede in den einzelnen Einkommen zu erklären sind und wie die Differenzen in den Haushaltseinkommen zustande kommen. Sozialpolitische Probleme führen weiterhin zu der Frage, wie sich die Aufteilung des (Volks)Einkommens auf bestimmte soziale Gruppen (Unterschicht bzw. „Arme“, Oberschicht bzw. „Reiche“ etc.) erklärt.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung und der Vergleich zweier modelltheoretischer Untersuchungen zu den oben skizzierten Fragestellungen. Hierbei handelt es sich zum einen um die Untersuchung von Kiminori Matsuyama aus dem Jahr 2000 und zum anderen um die Untersuchung von Philippe Aghion und Patrick Bolton aus dem Jahre 1997. In beiden Arbeiten wird u.a. die Frage untersucht, ob und unter welchen Annahmen Vermögen von der sozialen Gruppe der vermögenden Oberschicht („Reiche“) zur Gruppe der unvermögenden Unterschicht („Arme“) „durchsickern“ kann („trickle-down“-Effekt).
In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die beiden Modelle und die darin jeweils behandelten „trickle-down“-Effekte dargestellt. Danach wird der Versuch unternommen, die „trickle-down“-Effekte der beiden Modelle zu vergleichen, um dadurch die Unterschiede sowie die Annahmen, die zu den Unterschieden führen, herauszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung, Abgrenzung und Aufbau der Arbeit
- Der Beitrag von Kiminori Matsuyama
- Darstellung des Modells
- Steady-State-Analyse
- Skizzierung des ,,trickle-downs\"-Effekts
- Der Beitrag von Philippe Aghion und Patrick Bolton
- Darstellung des Modells
- Skizzierung des „trickle-down\"-Effekts
- Vergleich der „trickle-down“-Effekte der Modelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert zwei modelltheoretische Untersuchungen zu Einkommensungleichheit und Vermögensverteilung: die Arbeit von Kiminori Matsuyama (2000) und die von Philippe Aghion und Patrick Bolton (1997). Der Fokus liegt auf der Darstellung und dem Vergleich der jeweiligen „trickle-down“-Effekte, also der Frage, ob und wie Vermögen von der Oberschicht an die Unterschicht durchsickert. Die Arbeit von Aghion und Bolton wird aufgrund des Umfangs nur verbal erläutert.
- Einkommensungleichheit und ihre Ursachen
- Modelltheoretische Analyse von Vermögensverteilung
- Der „trickle-down“-Effekt in unterschiedlichen Modellen
- Vergleich der Annahmen und Ergebnisse verschiedener Modelle
- Analyse der Bedingungen für Vermögensumverteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung, Abgrenzung und Aufbau der Arbeit: Die Arbeit untersucht die Einkommensungleichheit und Vermögensverteilung anhand zweier Modelle: Matsuyama (2000) und Aghion & Bolton (1997). Der Schwerpunkt liegt auf Matsuyamas Modell, während Aghion & Bolton nur summarisch behandelt werden. Die Arbeit analysiert den "trickle-down"-Effekt, also das Durchsickern von Vermögen von Reichen zu Armen, in beiden Modellen und vergleicht die Ergebnisse.
Der Beitrag von Kiminori Matsuyama: Dieses Kapitel präsentiert Matsuyamas Modell zur Einkommensungleichheit. Das Modell beschreibt eine geschlossene Volkswirtschaft mit identischen Agenten, die ihr Vermögen entweder am Kapitalmarkt anlegen oder in unternehmerische Projekte investieren können. Die Produktionstechnologie ist dabei nicht linear und führt zu unterschiedlichen Renditen abhängig von der Investitionshöhe. Das Modell analysiert, wie die Vermögensverteilung über die Generationen hinweg dynamisch entsteht und welche Faktoren den „trickle-down“-Effekt beeinflussen. Die Steady-State-Analyse untersucht die langfristige Vermögensverteilung. Der Fokus liegt auf der Erklärung der Vermögensungleichheit und den Bedingungen für eine mögliche Umverteilung.
Der Beitrag von Philippe Aghion und Patrick Bolton: Dieses Kapitel gibt eine verbale Zusammenfassung des Modells von Aghion und Bolton (1997), welches ebenfalls den „trickle-down“-Effekt untersucht. Aufgrund des Umfangs werden die formalen Aspekte des Modells weggelassen. Die Diskussion konzentriert sich auf die grundlegenden Annahmen und die Kernaussagen des Modells bezüglich Vermögensverteilung und deren Dynamik im Vergleich zu Matsuyamas Modell.
Schlüsselwörter
Einkommensungleichheit, Vermögensverteilung, trickle-down-Effekt, Modelltheoretische Analyse, Steady-State-Analyse, Kiminori Matsuyama, Philippe Aghion, Patrick Bolton, Wirtschaftswachstum, Sozialpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Modelle von Matsuyama und Aghion & Bolton
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Arbeit analysiert zwei ökonomische Modelle zur Einkommensungleichheit und Vermögensverteilung: das Modell von Kiminori Matsuyama (2000) und das von Philippe Aghion und Patrick Bolton (1997). Der Fokus liegt auf dem Vergleich der jeweiligen „trickle-down“-Effekte, also der Frage, wie Vermögen von der Oberschicht an die Unterschicht durchsickert.
Welche Modelle werden untersucht?
Im Detail wird das Modell von Kiminori Matsuyama (2000) dargestellt und analysiert, welches eine geschlossene Volkswirtschaft mit identischen Agenten und unterschiedlichen Investitionsrenditen beschreibt. Das Modell von Aghion und Bolton (1997) wird aufgrund seines Umfangs nur verbal zusammengefasst und im Vergleich zu Matsuyamas Modell diskutiert.
Was ist der „trickle-down“-Effekt?
Der „trickle-down“-Effekt beschreibt das Durchsickern von Vermögen von wohlhabenden Schichten der Bevölkerung an ärmere Schichten. Die Analyse untersucht, ob und wie dieser Effekt in den beiden Modellen auftritt und welche Faktoren ihn beeinflussen.
Wie wird das Modell von Matsuyama analysiert?
Matsuyamas Modell wird durch die Darstellung des Modells selbst, eine Steady-State-Analyse (Analyse des langfristigen Gleichgewichts) und die Skizzierung des „trickle-down“-Effekts im Modell untersucht. Es wird analysiert, wie die Vermögensverteilung über die Generationen hinweg dynamisch entsteht und welche Faktoren den „trickle-down“-Effekt beeinflussen.
Wie wird das Modell von Aghion und Bolton behandelt?
Das Modell von Aghion und Bolton wird aufgrund seines Umfangs nur verbal erläutert. Die Analyse konzentriert sich auf die grundlegenden Annahmen und die Kernaussagen des Modells bezüglich Vermögensverteilung und deren Dynamik im Vergleich zu Matsuyamas Modell.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einkommensungleichheit und ihre Ursachen, die modelltheoretische Analyse von Vermögensverteilung, den „trickle-down“-Effekt in unterschiedlichen Modellen, den Vergleich der Annahmen und Ergebnisse verschiedener Modelle und die Analyse der Bedingungen für Vermögensumverteilung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Einkommensungleichheit, Vermögensverteilung, trickle-down-Effekt, Modelltheoretische Analyse, Steady-State-Analyse, Kiminori Matsuyama, Philippe Aghion, Patrick Bolton, Wirtschaftswachstum, Sozialpolitik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung mit Abgrenzung und Aufbau, ein Kapitel zu Matsuyamas Modell, ein Kapitel zur Zusammenfassung des Modells von Aghion und Bolton und einen Vergleich der „trickle-down“-Effekte beider Modelle.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Volkswirt Johannes Kalusche (Autor:in), 2004, Wachstum und Verteilung - Die Beiträge von Matsuyama und Aghion und Bolten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/30796