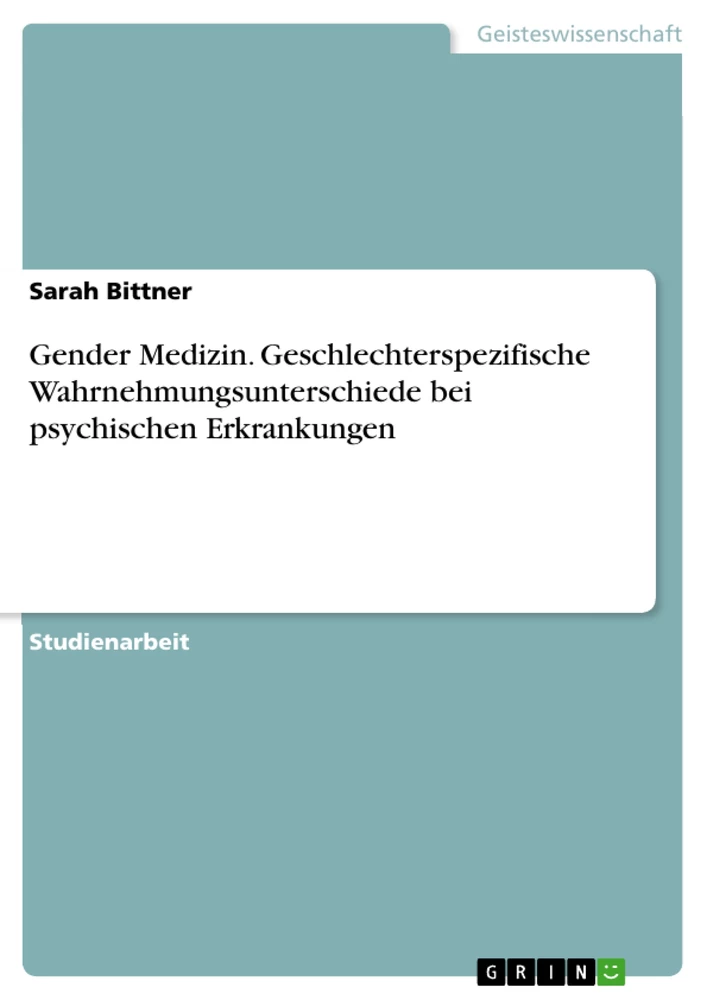In der Medizin ist es eine Gegebenheit, dass die beiden Geschlechter unterschiedlich empfinden. Sie fühlen nicht nur ihre körperlichen Erkrankungen verschiedenartig, sondern erleben und beschreiben auch die Symptomatik des gleichen Krankheitsbildes in ungleicher Ausprägung. Beide Geschlechter besitzen eine andere Wahrnehmung in Bezug auf das Erleben und Fühlen einer Krankheit. Diese Unterschiede haben weitreichende Folgen für die körperliche und seelische Gesundheit. Das neue Fachgebiet der Gender-Medizin, welches sich mit den Unterschieden von Gesundheit und Krankheit bei Männern und Frauen beschäftigt, rückt zunehmend in den Fokus der Forschung, Lehre und Fortbildung von Pharmazeuten und Medizinern. Innerhalb der folgenden Seiten, möchte ich hinsichtlich des Themas Gender-Medizin auf eine spezielle Frage gezielt eingehen: Beeinflussen geschlechtsspezifische Differenzen die Entstehung und den Verlauf von psychischen Erkrankungen? Um Antworten auf diese Fragestellung zu finden, wird sich diese Arbeit vorerst mit den Grundbausteinen der Gender-Medizin sowie mit ihren Erkenntnissen und Entwicklungen auseinandersetzen. Dabei ist es zu Beginn notwendig den Begriff „Gender“ genauer erläutern. Des Weiteren wird auf potenzielle geschlechtsspezifische Ungleichheiten in Bezug auf ausgewählte psychische Störungen eingegangen. Diese Auswahl beschränkt sich auf Schlafstörungen, Essstörungen, Schizophrenie sowie depressiven Störungen. Weiterhin wird sich mit dem Thema beschäftigt, ob geschlechtsspezifische Unterschiede innerhalb der Pharmakologie existieren. Hierbei wird speziell auf die Behandlung mit Psychopharmaka eingegangen. In einem letzten Gliederungspunkt wird ein kurzer Ausblick über die Chancen der Gender-Medizin gegeben, bevor in der abschließenden Zusammenfassung rückblickend auf die Forschungsfrage eingegangen wird, inwiefern geschlechtsspezifische Differenzen die Entstehung und den Verlauf von psychischen Erkrankungen beeinflussen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist unter dem Begriff „Gender“ zu verstehen?
- Einblicke in den Bereich der Gender-Medizin
- Geschlechtsspezifische Ungleichheiten und psychische Störungen
- Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Schlafstörungen
- Dualismus von Männern und Frauen im Hinblick auf das obstruktive Schlafapnoesyndrom
- Geschlechtstypische Ungleichheiten eines Restless Legs Syndroms
- Kontrast der Geschlechter im Hinblick auf Essstörungen
- Adipositas in Bezug zu den Geschlechtern
- Anorexia nervosa- ausschließlich eine Frauenkrankheit?
- Ursache und Verlauf von Schizophrenie im Hinblick auf die Geschlechter
- Unterschiede der Depressions-Ausprägungen bei Männern und Frauen
- Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Schlafstörungen
- Geschlechtscharakteristische Unterschiede in der Pharmakologie
- Chancen für eine Gender-Medizin
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern geschlechtsspezifische Unterschiede die Entstehung und den Verlauf von psychischen Erkrankungen beeinflussen. Sie beleuchtet den Bereich der Gender-Medizin und untersucht, wie geschlechtsspezifische Perspektiven in der Erforschung und Behandlung von psychischen Störungen berücksichtigt werden können.
- Definition und Bedeutung des Begriffs "Gender" im Kontext der Medizin
- Grundlagen und Entwicklungen der Gender-Medizin
- Analyse geschlechtsspezifischer Ungleichheiten bei ausgewählten psychischen Störungen (Schlafstörungen, Essstörungen, Schizophrenie, Depression)
- Untersuchung geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Pharmakologie, insbesondere bei der Behandlung mit Psychopharmaka
- Chancen und Herausforderungen der Gender-Medizin für eine personalisierte Gesundheitsversorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Gender-Medizin ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss geschlechtsspezifischer Unterschiede auf psychische Erkrankungen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs "Gender" und seiner Bedeutung im wissenschaftlichen Kontext. Das dritte Kapitel gibt einen Einblick in den Bereich der Gender-Medizin und beleuchtet die Entwicklung und Bedeutung dieses Fachgebiets für die Gesundheitsversorgung. Das vierte Kapitel analysiert geschlechtsspezifische Unterschiede bei Schlafstörungen, Essstörungen, Schizophrenie und Depression. Im fünften Kapitel werden geschlechtsspezifische Unterschiede in der Pharmakologie, insbesondere bei der Behandlung mit Psychopharmaka, untersucht. Das sechste Kapitel beleuchtet Chancen und Herausforderungen der Gender-Medizin für eine personalisierte Gesundheitsversorgung.
Schlüsselwörter
Gender-Medizin, Geschlechtsspezifische Unterschiede, Psychische Störungen, Schlafstörungen, Essstörungen, Schizophrenie, Depression, Pharmakologie, Psychopharmaka, Personalisierte Medizin.
- Quote paper
- Sarah Bittner (Author), 2014, Gender Medizin. Geschlechterspezifische Wahrnehmungsunterschiede bei psychischen Erkrankungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/306458