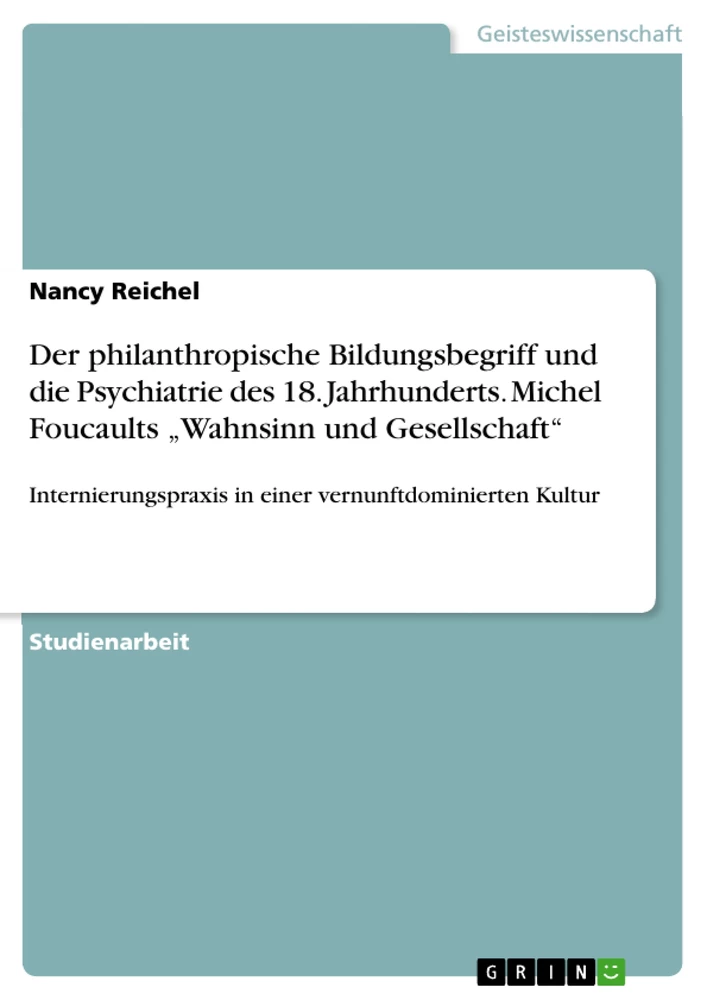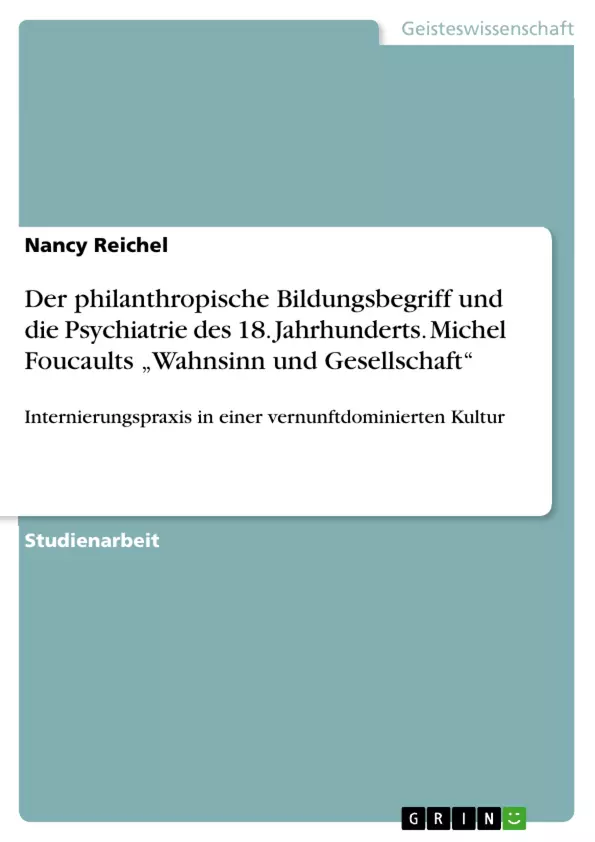In dieser Arbeit wird die Frage gestellt, ob in Foucaults Darstellung des Phänomens Internierungspraxis in seinem Werk „Wahnsinn und Gesellschaft“ neben anthropologischen und kulturellen Aspekten auch ein Bildungsprogramm nachgewiesen werden kann, dem sich Geisteskranke unterziehen müssen, um den Wahnsinn zu „verdrängen“. Es wird versucht, vom Bildungskonzept des Philanthropismus Parallelen zu Foucaults Internierungspraxis aufzuweisen.
Die Arbeit konzentriert sich ausschließlich auf Foucaults Werk „Wahnsinn und Gesellschaft“. Dafür wird im zweiten Kapitel herausgearbeitet, was Foucault unter dem Begriff Wahnsinn versteht. Die Schwerpunkte werden auf die Eigenschaft des „Fehlens von Arbeit“, auf den Wahnsinn als Gegenpol zur Vernunft und auf die Geisteskrankheit gelegt.
Der Umgang mit dem Wahnsinn hat sich im Laufe der europäischen Geschichte verändert. Foucault hat einen kulturellen Prozess herausgestellt, der im Kapitel „Der Wahnsinn im geschichtlichen Abriss“ umrissen wird. Das vierte Kapitel versucht nun die dargelegten Überlegungen Foucaults mit einem Bildungskonzept in Verbindung zu bringen. Dabei wird sich zunächst allgemein mit dem Begriff Bildung auseinandergesetzt, um sich dann dem Bildungsbegriff im 18. Jahrhundert, in der Zeit der Internierungspraxis zu nähern. Dabei werden Parallelen zwischen der Psychiatrie im 18. Jahrhundert und dem Bildungskonzept des Philanthropismus herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Begriff Wahnsinn
- 2.1 Das Fehlen von Arbeit
- 2.2 Das Verhältnis von Vernunft und Wahnsinn
- 2.3 Die Geisteskrankheit
- 2.4 Bewusstseinsformen des Wahnsinns
- 3. Der Wahnsinn im geschichtlichen Abriss
- 3.1 Entwicklung der Internierungspraxis
- 3.2 Erklärungsmuster von Geisteskrankheiten
- 4. Der Bildungsprozess innerhalb der Internierungspraxis
- 4.1 Der Begriff Bildung
- 4.2 Bildung im Philanthropismus
- 4.3 Psychiatrie als Bildungsinstitution
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Michel Foucaults "Wahnsinn und Gesellschaft" und fragt nach einem möglichen Bildungsprogramm innerhalb der von Foucault beschriebenen Internierungspraxis. Sie untersucht, ob neben anthropologischen und kulturellen Aspekten auch ein erzwungener Bildungsprozess zur "Verdrängung" des Wahnsinns nachweisbar ist. Hierzu werden Parallelen zum Bildungskonzept des Philanthropismus gezogen.
- Foucaults Konzept des Wahnsinns als kulturelles Phänomen
- Die Entwicklung der Internierungspraxis in der europäischen Geschichte
- Das "Fehlen von Arbeit" als Kennzeichen des Wahnsinns nach Foucault
- Der Vergleich der Psychiatrie des 18. Jahrhunderts mit dem Philanthropismus
- Die Rolle der Vernunft und ihres Verhältnisses zum Wahnsinn
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt Foucaults Werk "Wahnsinn und Gesellschaft" und seine zentrale These von der Trennung von Vernunft und Wahnsinn in der abendländischen Kultur. Foucault analysiert die Entwicklung der Internierungspraxis und betrachtet diese als Schlüssel zum Verständnis des Umgangs mit Geisteskranken. Die Arbeit selbst untersucht, ob in Foucaults Analyse ein implizites Bildungsprogramm erkennbar ist, das Geisteskranke zur Anpassung zwingt, und vergleicht dies mit dem Philanthropismus.
2. Der Begriff Wahnsinn: Dieses Kapitel beleuchtet Foucaults Verständnis von Wahnsinn. Foucault betrachtet Wahnsinn nicht als medizinische Kategorie, sondern als ein kulturelles Konstrukt, dessen Definition sich im Laufe der Geschichte verändert hat. Er analysiert verschiedene Bezeichnungen für Wahnsinn, von "Hybris" im antiken Griechenland bis zum "Geisteskranken" im 19. Jahrhundert. Ein zentraler Aspekt ist das "Fehlen von Arbeit" als gesellschaftliche Definition von Wahnsinn, was Geisteskranke, Arbeitslose und Bettler zusammenführt.
3. Der Wahnsinn im geschichtlichen Abriss: Dieses Kapitel skizziert die historische Entwicklung des Umgangs mit Wahnsinn. Foucault zeigt, wie sich die Internierungspraxis entwickelte und wie sich die Erklärungsmuster von Geisteskrankheiten im Laufe der Zeit veränderten. Der Fokus liegt auf dem kulturellen und gesellschaftlichen Wandel, der zu einer zunehmenden Trennung zwischen Vernunft und Wahnsinn führte.
4. Der Bildungsprozess innerhalb der Internierungspraxis: Dieses Kapitel untersucht die Verbindung zwischen Foucaults Darstellung der Internierungspraxis und dem Konzept der Bildung. Es analysiert den Begriff der Bildung allgemein und im Kontext des Philanthropismus des 18. Jahrhunderts, um Parallelen zur Psychiatrie dieser Zeit aufzuzeigen. Der Schlüssel liegt in der Analyse, ob die Internierung selbst als ein erzwungener Bildungsprozess interpretiert werden kann, der auf die Anpassung der Betroffenen an die gesellschaftlichen Normen abzielt.
Schlüsselwörter
Michel Foucault, Wahnsinn, Gesellschaft, Internierungspraxis, Vernunft, Bildung, Philanthropismus, Geisteskrankheit, Arbeit, kulturelles Konstrukt, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zu "Wahnsinn und Gesellschaft": Eine Bildungsanalyse nach Foucault
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Michel Foucaults Werk "Wahnsinn und Gesellschaft" unter dem Aspekt eines möglichen impliziten Bildungsprogramms innerhalb der von Foucault beschriebenen Internierungspraxis. Sie untersucht, ob neben anthropologischen und kulturellen Aspekten auch ein erzwungener Bildungsprozess zur Anpassung von Geisteskranken an die Gesellschaft nachweisbar ist und zieht Parallelen zum Bildungskonzept des Philanthropismus.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Foucaults Konzept des Wahnsinns als kulturelles Phänomen, die historische Entwicklung der Internierungspraxis, das "Fehlen von Arbeit" als Kennzeichen des Wahnsinns nach Foucault, den Vergleich der Psychiatrie des 18. Jahrhunderts mit dem Philanthropismus und die Rolle der Vernunft und ihres Verhältnisses zum Wahnsinn.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Begriff des Wahnsinns nach Foucault, ein Kapitel zur historischen Entwicklung des Umgangs mit Wahnsinn, ein Kapitel zum Bildungsprozess innerhalb der Internierungspraxis und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der vorliegenden Zusammenfassung detailliert beschrieben.
Was ist Foucaults Verständnis von Wahnsinn?
Foucault betrachtet Wahnsinn nicht als medizinische Kategorie, sondern als ein kulturelles Konstrukt, dessen Definition sich im Laufe der Geschichte verändert hat. Ein zentraler Aspekt ist das "Fehlen von Arbeit" als gesellschaftliche Definition von Wahnsinn.
Wie entwickelt sich der Umgang mit Wahnsinn historisch?
Die Arbeit skizziert die historische Entwicklung der Internierungspraxis und zeigt, wie sich die Erklärungsmuster von Geisteskrankheiten im Laufe der Zeit veränderten. Der Fokus liegt auf dem kulturellen und gesellschaftlichen Wandel, der zu einer zunehmenden Trennung zwischen Vernunft und Wahnsinn führte.
Welche Rolle spielt der Philanthropismus?
Der Philanthropismus des 18. Jahrhunderts dient als Vergleichsmodell, um Parallelen zur Psychiatrie dieser Zeit aufzuzeigen und zu untersuchen, ob die Internierung als erzwungener Bildungsprozess interpretiert werden kann, der auf die Anpassung der Betroffenen an gesellschaftliche Normen abzielt.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die Zusammenfassung enthält kein explizites Fazit. Das Fazit im eigentlichen Text müsste konsultiert werden, um diese Frage zu beantworten.)
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Michel Foucault, Wahnsinn, Gesellschaft, Internierungspraxis, Vernunft, Bildung, Philanthropismus, Geisteskrankheit, Arbeit, kulturelles Konstrukt, historische Entwicklung.
- Quote paper
- Nancy Reichel (Author), 2014, Der philanthropische Bildungsbegriff und die Psychiatrie des 18. Jahrhunderts. Michel Foucaults „Wahnsinn und Gesellschaft“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/306193