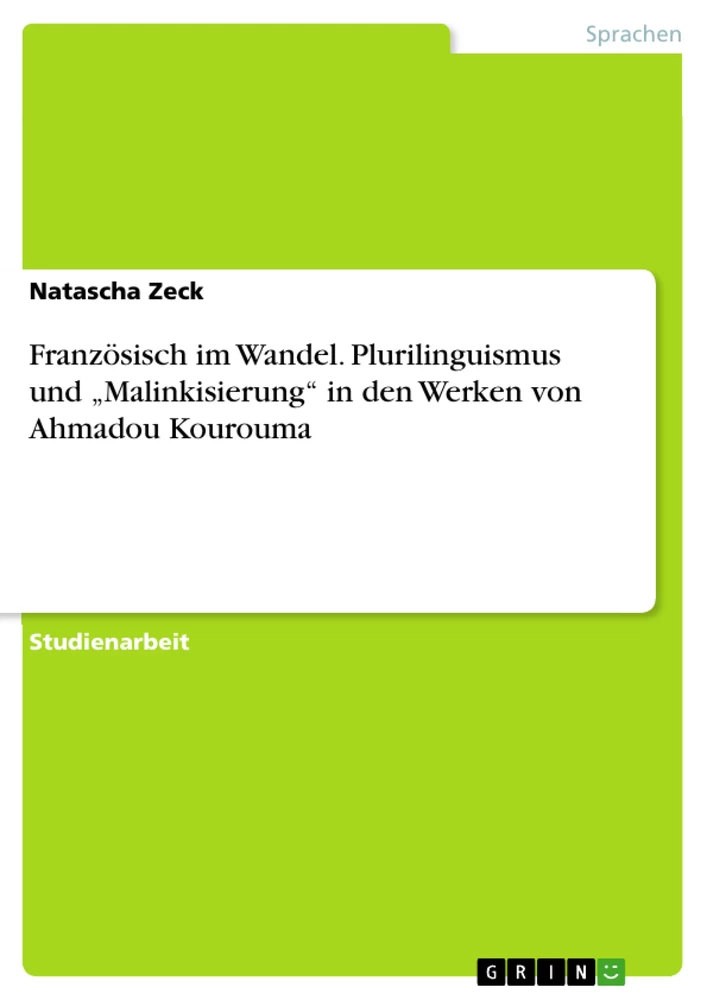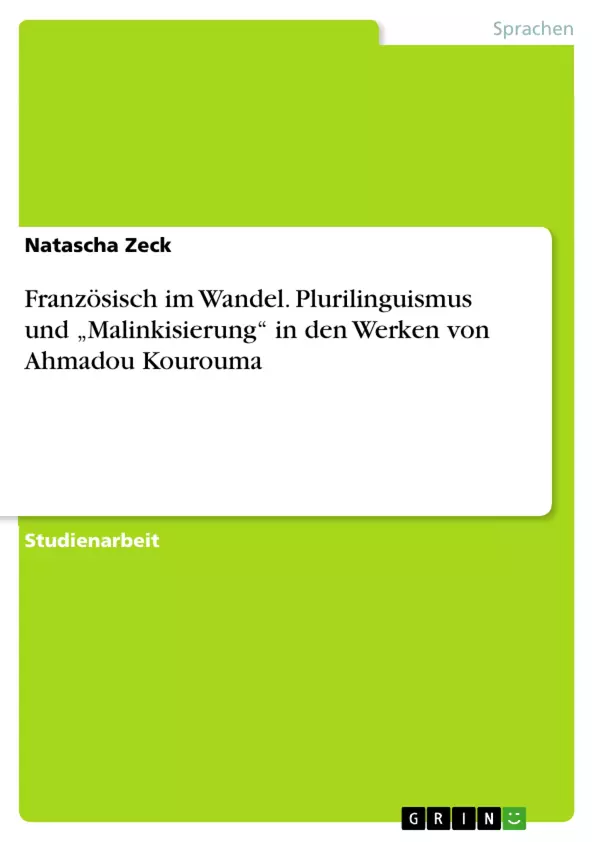Bei Beschäftigung mit der Frage, welche Faktoren langfristig dazu beigetragen haben, eine französische Sprachnorm zu konstituieren, stößt man gleich zu Beginn auf die enge Verbindung zwischen der französischen Sprache und ihrer Literatur. Bereits in frühen Jahrhunderten kristallisierte sich die Funktion der französischen Literatur als Bezugspunkt und Ideal für die Verwendung des Französischen hinaus. In einer wechselseitigen Beziehung war die Literatursprache somit zugleich Ausdruck der herrschenden Norm als auch das Medium, durch das die Konstituierung dieser Norm erfolgte.
Während zu einer Zeit relativer kultureller und sprachlicher Einheit innerhalb des Hexagons noch Ideale wie Natürlichkeit, Reinheit und Klarheit der französischen Klassiker als maßgeblich für den bon usage der französischen Sprache galten, lässt sich ab Beginn der postkolonialen Literatur eine deutliche Veränderung dieses Konzepts beziehungsweise auch das Aufbrechen bisheriger Normen feststellen. Die postkolonialen Autoren mussten sich hierbei direkt damit auseinandersetzen, in welcher Weise das Schreiben in der französischen Sprache, der Sprache der ehemaligen Kolonialherren, die Konzeption und Repräsentation der eigenen Identität beeinflusste oder gegebenenfalls auch beeinträchtigte. Es entstand die Frage, inwieweit man kulturelle Eigenidentität einbüßte, indem man sich der Sprache des Landes bediente, das das eigene Land vorher unterworfen und regiert hatte.
Ahmadou Kourouma hat seine eigene Methode gefunden, um mit dieser schwierigen Thematik umzugehen. Seine Werke haben unter Literaturkritikern und Sprachwissenschaftlern eine große Debatte ausgelöst. Hierbei wird insbesondere die Frage nach der Sprache Kouroumas aufgeworfen, die das erreichen soll, was dem eigenen Land unter französischer Herrschaft nicht möglich war: die eigene Identität durch das Medium der französischen Sprache zu kreieren, ohne dass die Verwendung des Französischen jedoch die Niederlage ausdrücken würde, die dies vor der Unabhängigkeit noch bedeutet hatte. So wird das Schreiben auf Französisch als eine Möglichkeit „de témoigner d’un peuple qui a été violé dans cette langue-là“ gesehen. In diesem Sinn verwendet Kourouma die französische Sprache, „en [la] colonisant à son tour“, um so die eigene kulturelle Identität zurückzuerobern und zu konstituieren.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Entstehung frankophoner Literaturen im Postkolonialismus
- Das Konzept des Plurilinguismus im frankophonen Roman
- Plurilinguismus bei Kourouma: Von der Oralität des malinké zur Schriftkultur
- Le métissage der französischen Sprache: sprachliche Modifikationen in den Werken Kouroumas
- Metaebene der Sprache
- Lexikalische Ebene
- Semantische und grammatische Ebene
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit analysiert die Auswirkungen der Entstehung von frankophonen Literaturen auf die französische Sprachnorm und untersucht die spezifische sprachliche Konzeption des ivorischen Autors Ahmadou Kourouma. Dabei wird auf das Konzept des Plurilinguismus eingegangen und die Integration malinké-sprachlicher Elemente in seine Werke beleuchtet.
- Die Entwicklung des Plurilinguismus in frankophonen Literaturen
- Die „Malinkisierung“ des Französischen in den Werken von Ahmadou Kourouma
- Der Einfluss der Oralität und des malinké auf Kouroumas sprachlichen Stil
- Die sprachlichen Modifikationen auf verschiedenen Ebenen: Metaebene, Lexik, Semantik und Grammatik
- Die Bedeutung von Kouroumas Werk für die afrikanische Literatur und die Rezeption des Französischen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel erläutert die enge Verbindung zwischen der französischen Sprache und Literatur und verdeutlicht, wie die Konstituierung einer französischen Sprachnorm durch die Literatur erfolgte. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehung von frankophonen Literaturen nach der Unabhängigkeit ehemaliger französischer Kolonien und die damit einhergehende sprachlich-kulturelle Pluralisierung. In diesem Zusammenhang wird das Konzept des Plurilinguismus im frankophonen Roman beleuchtet.
Das dritte Kapitel fokussiert auf die Werke von Ahmadou Kourouma, die sich durch einen besonderen Plurilinguismus und eine „Malinkisierung“ des Französischen auszeichnen. Es wird untersucht, wie Kourouma die Oralität des malinké in seine literarischen Werke integriert und die französische Sprache auf verschiedenen Ebenen modifiziert. Das vierte Kapitel bietet eine Schlussbetrachtung, die die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und die Bedeutung von Kouroumas Werk für die afrikanische Literatur beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Frankophone Literatur, Plurilinguismus, „Malinkisierung“, Ahmadou Kourouma, Oralität, Sprachnorm, Postkolonialismus, afrikanische Literatur, kulturelle Identität, literarische Tradition, sprachliche Modifikationen, Metaebene, Lexik, Semantik, Grammatik.
- Arbeit zitieren
- Natascha Zeck (Autor:in), 2014, Französisch im Wandel. Plurilinguismus und „Malinkisierung“ in den Werken von Ahmadou Kourouma, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/305766