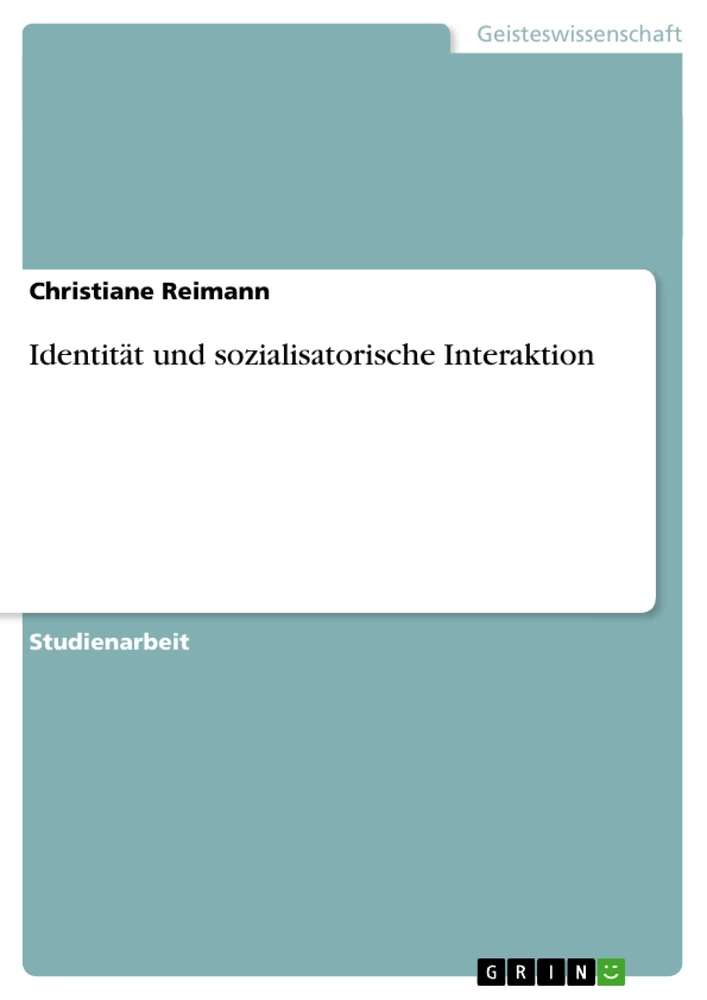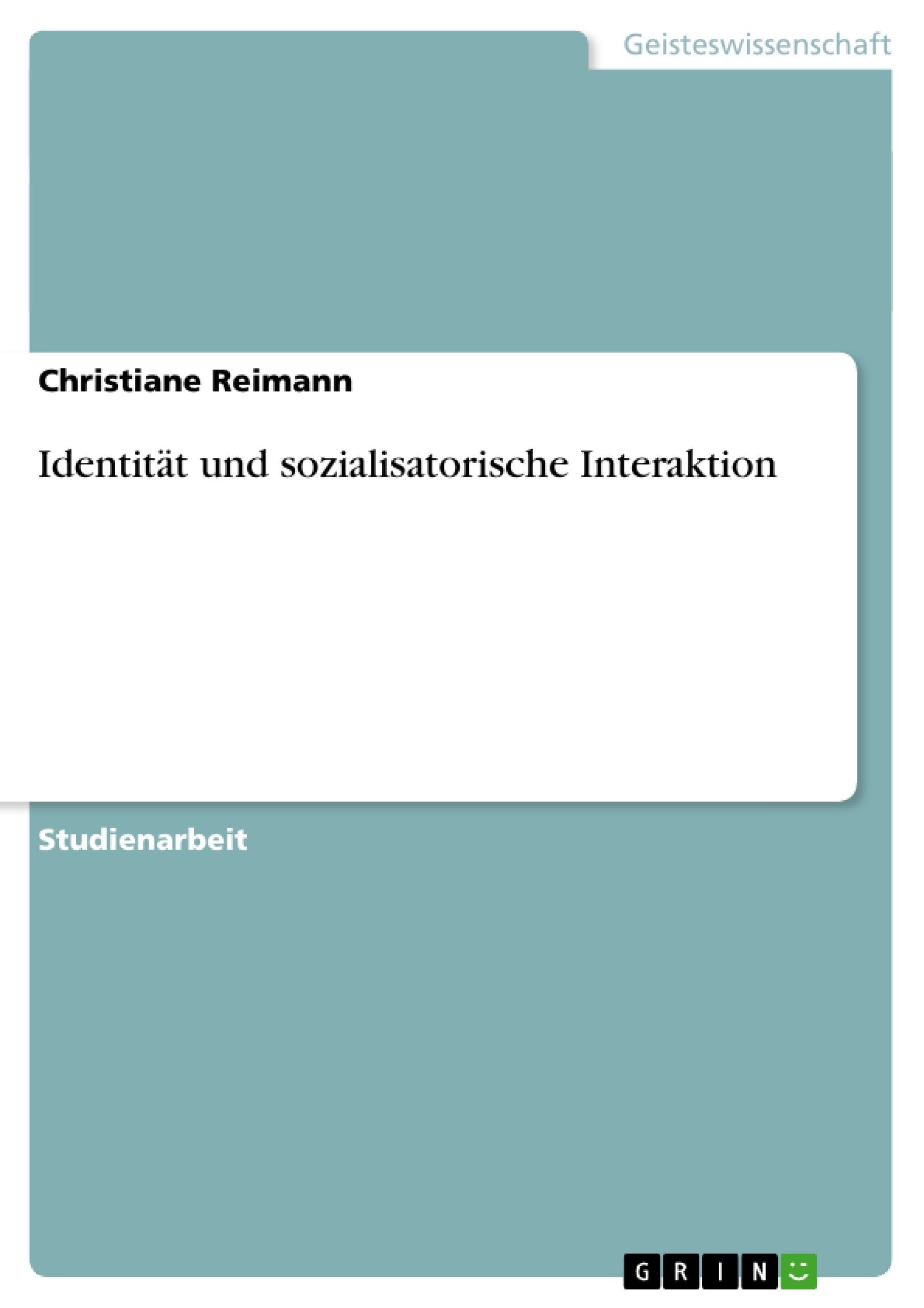Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung von Identität vor dem Hintergrund Familie und deren Bildung, sowie der Berücksichtigung der sprachlichen Kompetenz. Die Arbeit betrachtet dabei primär die Ansichten Oevermanns und Allerts.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprache und Identität
- Familie
- Die Konstitution der Dyade
- Die Erweiterung der Dyade zur Triade
- Der menschliche Bildungsprozess in der Triade
- Die Sozialisatorische Interaktion
- Theoretische Überlegungen
- Verortung der Sozialisationsforschung in der Soziologie
- Erläuterung der These
- Die Struktur der sozialisatorischen Interaktion
- Latente Sinnstruktur
- Methodologisches Vorgehen
- Empirisches Beispiel
- Theoretische Überlegungen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Rolle der Familie bei der Bildung der Identität zu untersuchen. Dabei soll die sozialisatorische Interaktion im Kontext der Familie analysiert werden, um die Entstehung von Identität und die Entwicklung von Kompetenzen im Sozialisationsprozess zu beleuchten.
- Die Bedeutung der Familie als primäres Sozialisationsfeld
- Der Einfluss von Sprache und Kommunikation auf die Identitätsbildung
- Die Rolle von Interaktionen und Rollen innerhalb der Familie
- Die Entstehung von Kompetenzen durch sozialisatorische Interaktion
- Die Bedeutung der latenten Sinnstruktur der sozialisatorischen Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor, die die Bedeutung der Familie für die Bildung der Identität im Sozialisationsprozess hervorhebt. Die Erweiterung der Dyade (Eltern) zur Triade (Eltern und Kind) bietet dem Kind die Möglichkeit, die Gesellschaft im Kleinen kennenzulernen und sich in verschiedenen Rollen und Interaktionen auszuprobieren. Dabei spielen Sprache und die Bildung von Kompetenzen eine entscheidende Rolle.
Sprache und Identität
Das Kapitel befasst sich mit der Rolle der Sprache im Sozialisationsprozess. Sprache dient nicht nur der Benennung von Objekten, sondern auch der Kommunikation und der Entwicklung von Denkfähigkeit. Die Sprache der sozialisierenden Erwachsenen wird an das Kind herangetragen, wodurch es seine eigene Identität und die Welt um sich herum reflektieren kann. Die Sprache vermittelt dem Kind zudem Normen, Werte und Einstellungen, die zur Vergesellschaftung und Individuierung beitragen.
Familie
Der Abschnitt „Familie“ untersucht die Konstitution und Struktur der Familie als primäres Sozialisationsfeld. Die Analyse der Dyade (Eltern) und ihrer Erweiterung zur Triade (Eltern und Kind) zeigt, welche Möglichkeiten und Herausforderungen sich für die kindliche Entwicklung ergeben. Der Fokus liegt auf den Interaktionsformen und Rollen innerhalb der Familie sowie auf dem Einfluss der Eltern auf die Entwicklung von Verhaltens- und Interaktionsregeln.
Die Sozialisatorische Interaktion
Dieses Kapitel widmet sich der sozialisatorischen Interaktion als grundlegendem Prozess der Identitätsbildung. Es werden theoretische Überlegungen zur Verortung der Sozialisationsforschung in der Soziologie angestellt und die These der Arbeit erläutert. Weiterhin werden die Struktur und die latente Sinnstruktur der sozialisatorischen Interaktion im Detail beleuchtet. Die Analyse des methodischen Vorgehens ermöglicht es, die Interaktion zwischen Eltern und Kind besser zu verstehen und die Entstehung von Kompetenzen im Sozialisationsprozess zu erklären.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Identität, Sozialisation, Familie, Interaktion, Sprache, Kompetenzbildung und die latente Sinnstruktur. Es werden wichtige Konzepte aus der Soziologie und der Sozialisationsforschung aufgegriffen, um die Entstehung der Identität im Kontext der Familie zu analysieren.
- Quote paper
- Christiane Reimann (Author), 2004, Identität und sozialisatorische Interaktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/30572